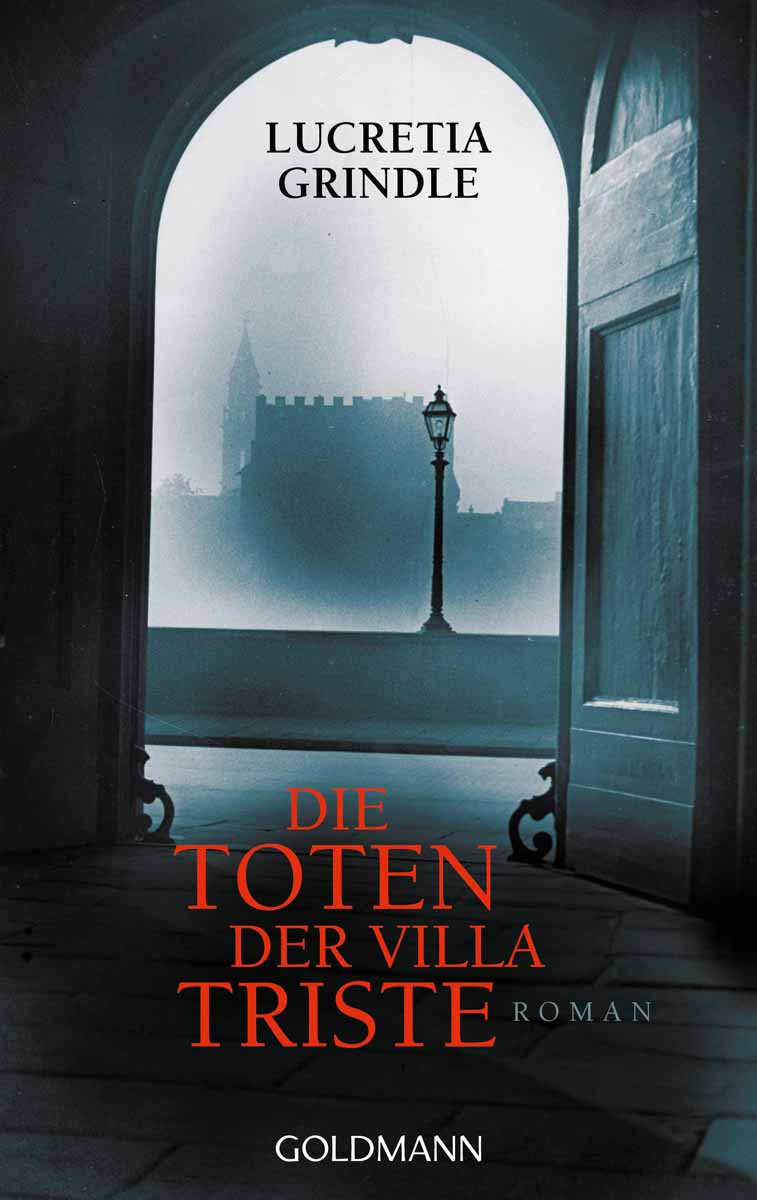![Die Toten der Villa Triste]()
Die Toten der Villa Triste
Emmelina berichtete, sobald sie die Neuigkeit erfahren habe, sei sie nach oben gegangen, um »Enricos Zimmer fertig zu machen«. Mein älterer Bruder hatte vor Kurzem den Wehrdienst angetreten und war in der Nähe von Rom stationiert. Emmelina meinte, Mama sei absolut sicher, dass er jetzt, da der Krieg zu Ende sei, jeden Moment heimkommen würde. Sie hatte Emmelina erklärt, dass sein bestes Anzugjackett aus dem Schrank geholt und aufgebügelt werden sollte.
Ich machte mir nicht einmal die Mühe, mir das Gesicht zu waschen oder gar mein verknittertes, verschwitztes Kleid auszuziehen. Stattdessen marschierte ich geradewegs in Papas Arbeitszimmer. Drinnen schloss ich die Tür, lehnte mich dagegen und ließ den dunklen, kühlen Raum auf mich wirken, der so nach meinem Vater roch. Nach seinen Büchern und den staubigen Zeitungen. Und nach dem Acqua di Colonna, das er auflegte, vermischt mit dem dezenten, zu Kopf steigenden Aroma der Zigarre, die er sich jeden Sonntagnachmittag gönnte.
Ich atmete tief durch und wanderte über den dunkel gemusterten Teppich. Auf Papas Schreibtisch stand ein Foto unserer Mutter, eines großen, blonden Mädchens mit breitem Lächeln. Es war vor fast dreißig Jahren aufgenommen worden, aber sie hatte sich eigentlich kaum verändert. Mit fünfzig war sie immer noch eine schöne Frau – mit starken Knochen, zarter Haut und den dunkelblauen Augen, die sie all ihren Kindern vererbt hatte. Enrico und ich hatten Papas dunkles Haar. Isabella hatte ihre Löwenmähne von Mama geerbt.
Lodovico hatte Vettern in Caserta, und ich war überzeugt – nachdem sie in der Nähe von Neapel, seinem Heimathafen, wohnten –, dass sie wissen würden, wo sein Schiff war. Ich hatte erfahren, dass es demnächst mit seiner Fracht von Verstümmelten und Sterbenden eintreffen sollte. Sein letzter Brief hatte mir versprochen, dass er mir schreiben oder, falls er konnte, mich anrufen würde, sobald sie anlegten. Aber ich konnte nicht warten. Auf der Radfahrt nach Hause hatte ich wieder einmal mit absoluter Gewissheit gespürt, dass sie bombardiert worden waren. Dass die Deutschen sie auf See attackiert hatten, sobald auch nur das Gerücht eines Waffenstillstands durchgesickert war. Ich war überzeugt davon. Also setzte ich mich in Papas Stuhl und griff nach dem Telefon. Meine Hand schloss sich feucht um den Hörer. Aber ich hörte nur ein totes, leeres Summen.
Menschen stampften im Flur auf und ab. Aus dem Esszimmer hörte ich, wie Emmelina ihre Nichte zurechtwies. Immer wieder probierte ich es. Aber als ich endlich ein Fräulein vom Amt in der Leitung hatte, bekam ich erklärt, dass meine Bemühungen vergeblich seien. Ganz Florenz, ganz Italien wollte eine freie Leitung. Als Papa schließlich die Tür öffnete und hereinkam, war es schon nach fünf Uhr.
Er stand mit dem Licht im Rücken, weshalb ich seine Miene eher erahnen als erkennen konnte. Mein Vater war Universitätsprofessor und hatte sich auf Boccaccio spezialisiert. Er war, wie fast jeder in unserem Bekanntenkreis, Antifaschist. Und genau wie alle Antifaschisten in ganz Italien hatte er seit dem fünfundzwanzigsten Juli, dem Tag von Mussolinis Absetzung, gespürt, dass er freier atmen konnte. Papa war nie ein Agitator gewesen oder auch nur das, was man als Aktivist bezeichnen könnte. Stattdessen hatte er still, ohne großes Aufheben und recht geschickt Widerstand geleistet. Trotzdem hatte er bestimmt unter beträchtlichem Druck gestanden. Vor etwa einem Monat hatten wir auf der Terrasse gesessen, als er sich mir zugewandt hatte, das schmale Gesicht weich im Abendlicht, und mir gestanden hatte, dass er nie wirklich geglaubt habe, diesen Tag noch zu erleben. Dass er es immer noch nicht wirklich fassen könne, so als hätte er ganz überraschend festgestellt, dass er seit über zwanzig Jahren den Atem angehalten hatte.
Jetzt wirkten seine Schultern nicht mehr so steif. Sein Leinenanzug war genauso verknittert wie mein Kleid. Genau wie meine Mutter hatte mein Vater blaue Augen. Sie waren nicht so dunkel wie ihre, dafür größer und runder. Hinter dem Drahtgestell seiner Brille wirkten sie wie Kinderaugen. Mama hatte einst erzählt, sie hätte ihn geheiratet, weil er wie ein Dichter ausgesehen habe. Inzwischen war sein Haar grau gesprenkelt. Es fiel ihm immer noch in die Stirn. Er hatte die Angewohnheit, es beim Reden zurückzuschieben.
»Caterina?« Der Siegelring, den er neben dem Ehering an der linken Hand trug, fing das Licht ein, das durch die halb
Weitere Kostenlose Bücher