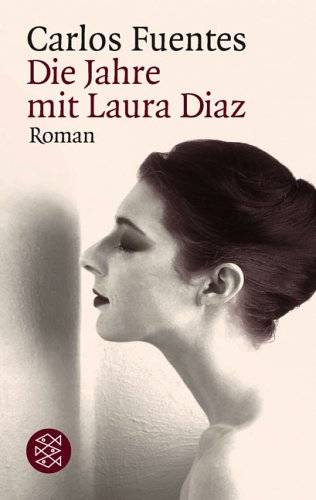![Die Jahre mit Laura Diaz]()
Die Jahre mit Laura Diaz
Dunkelheit.
Es war eine andauernde Dunkelheit, eine der Stadt fest zugehörige Finsternis, ihre Begleiterin, ihr getreuer Spiegel. Ich brauchte mich nur einmal im Kreis zu drehen und mich inmitten der gleichförmigen, grauen Wüstenei zu sehen. Hier und da von Pfützen geschmückt, von vergänglichen Pfaden, die furchtsame Füße hinterlassen hatten, von nackten Bäumen, noch schwärzer als diese Landschaft nach der Schlacht. Fern, gespenstisch waren Hausruinen zu erblicken, Gebäude aus dem letzten Jahrhundert mit eingesunkenen Dächern, eingestürzten Schornsteinen, blinden Fensterscheiben, kahlen Vorhöfen, ramponierten Türen; hier und da schmiegte sich ein verdorrter Baum zärtlich und schamlos an eine schmutzige Dachluke. Ein einsamer Schaukelstuhl wippte knarrend und erinnerte mich vage an andere Zeiten, von denen im Gedächtnis kaum eine Ahnung blieb.
Einsame Gefilde, düstere Höhe, wiederholte ich eine Erinnerung aus der Schulzeit, während meine Hände die Kamera nahmen und ich mich wieder vor mir sah, wie ich von Bild zu Bild eilte, Mexico fotografierte, Buenos Aires, wenn auch nicht vom Fluß aus, Rio, wenn auch nicht vom Meer, Carajo-Caracas, das entsetzliche Lima, Bogota, ohne heiligen Glauben oder mit, das hoffnungslose Santiago. Ich zeichnete das zukünftige Geschick unserer lateinamerikanischen Städte in die Gegenwart der größten aller Industriemetropolen, des Zentrums des Automobilbaus, der Wiege der Fließbandarbeit und des Mindestlohns: Detroit, Michigan. Ich fotografierte alles, die alten Karosserien, die einsam auf den noch einsameren Ödflächen lagen, die unverhofft auftauchenden, mit Glasscherben gepflasterten Straßen, die aufflimmernden Lichter der kleinen Läden. Was gab es dort?
Was verkaufte man an den wenigen beleuchteten Ecken dieses ungeheuren schwarzen Lochs? Beinahe geblendet betrat ich eine der Buden, um eine Limonade zu bestellen.
Ein Paar, ebenso aschgrau wie der Tag, musterte mich mit einem Blick, der spöttisch, schicksalsergeben, einladend und boshaft zugleich war. Sie fragten, was ich wollte, und antworteten, hier gebe es alles.
Ich war wie benommen, vielleicht war es auch nur die Gewohnheit, jedenfalls verlangte ich auf spanisch eine »Coca«. Die beiden lachten blödsinnig.
»Wir Chaldäer verkaufen nur Bier und Wein«, sagte der Mann, »keine Drogen.«
»Dafür Lotterielose«, setzte die Frau hinzu.
Beinahe instinktiv lief ich zum Hotel zurück, zog die Schuhe aus, verschmiert mit dem Müll des Vergessens, und wollte mich gerade zum zweitenmal an diesem Tag duschen, als ich auf die Uhr sah. Das Team erwartete mich bereits in der Hotelhalle, und pünktlich zu sein war mein Markenzeichen, ich hatte ausdrücklich darum gebeten. Während ich mir die Jacke überstreifte, betrachtete ich vom Fenster aus die Landschaft draußen. Detroit war gleichzeitig eine christliche und eine islamische Stadt. Licht beschien die Spitzen der Wolkenkratzer und der Moscheen. Die übrige Welt lag weiter im Dunkeln.
Unser Team machte sich auf zum Kunstinstitut. Zunächst ging es erneut durch endlose Einöde, Straßengevierte aus Brachland, hier und da die Ruine einer viktorianischen Villa und am Ende der Stadtwüste (oder vielmehr in ihrer eigentlichen Mitte) ein kitschiges Gebäude vom Anfang des Jahrhunderts, sauber jedoch, gut erhalten und geräumig, über eine breite Steintreppe und durch hohe Glas- und Eisentüren zugänglich: ein glückliches Mémento im großen Reisekoffer der Mißgeschicke, eine aufrechte, juwelengeschmückte Greisin, die alle ihre Nachkommen überlebt hatte, eine Rachel ohne Tränen. The Detroit Institute of Arts.
Im riesigen, von einem hohen Glasdach geschützten zentralen Innenhof fand eine Blumenausstellung statt, in der sich das Publikum drängte.
»Wo man die wohl hergeholt hat?« fragte ich einen Gringo aus dem Team, der mir mit einem Achselzucken antwortete, ohne die Überfülle der Tulpen, Chrysanthemen, Lilien und Gladiolen auch nur eines Blickes zu würdigen. Wir durchquerten den Hof in schnellem Tempo. Fernsehen und Film sind Aufgaben, die man im Eiltempo hinter sich zu bringen hat, denn schon drängt die Zeit zum Schnitt. Leider können sich die, die davon leben, keine andere Beschäftigung vorstellen, und so filmen sie und filmen und filmen. Wir sind zum Arbeiten gekommen.
Wir kamen zu Rivera, Diego – Diego Maria aus Guanajuato, Diego Maria Concepcion Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodrïguez, 1886-1957.
Man
Weitere Kostenlose Bücher