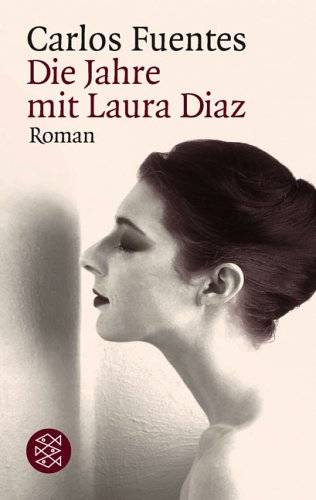![Die Jahre mit Laura Diaz]()
Die Jahre mit Laura Diaz
I. Detroit: 1999
Ich kannte die Geschichte. Nicht die Wahrheit. Selbst der Grund meiner Anwesenheit war in gewisser Weise eine Lüge. Ich kam nach Detroit, um mit einer Fernsehdokumentation über die mexikanischen Wandmaler und ihre Werke in den Vereinigten Staaten zu beginnen. Insgeheim interessierte es mich jedoch mehr, den Niedergang einer Großstadt zu fotografieren, des ersten Zentrums der Automobilindustrie, nichts weniger; des Ortes, an dem Henry Ford die Serienfertigung jener Maschine erfand, die unser Leben mehr als jede Regierung bestimmt.
Einer der Beweise für die große Bedeutung der Stadt ist, daß sie 1932 den mexikanischen Künstler Diego Rivera einlud, die Wände des Detroit Institute of Arts mit Gemälden zu schmücken, und heute, 1999, kam ich – so der offizielle Grund meiner Reise –, um eine Fernsehserie über dieses und andere mexikanische Wandbilder in den Vereinigten Staaten zu drehen. Ich wollte mit Rivera in Detroit anfangen, mit Orozco in Dartmouth und Kalifornien weitermachen und mir danach einen geheimnisvollen Siqueiros vornehmen, den es, laut Auftrag, in Los Angeles zu entdecken galt. Schließlich sollten die verschollenen Werke von Rivera selbst folgen: das Wandgemälde im Rockefeller Center, das vernichtet wurde, weil es Lenin und Marx zeigte, und die Serie für die New School – mehrere große Bildflächen, die ebenfalls verschwunden sind.
So mein Auftrag. Und ich hatte auch einen persönlichen Grund, warum ich unbedingt in Detroit damit anfangen wollte. Ich wollte den Verfall dieser Industriemetropole fotografieren, zum würdigen Gedenken an unser schreckliches zwanzigstes Jahrhundert. Wozu mich weder der Wunsch trieb, als sittlicher Mahner aufzutreten, noch irgendeine apokalyptische Vorliebe für Elend und Häßlichkeit, nicht einmal einfacher Humanismus.
Ich bin Fotograf, wenn auch nicht der wunderbare Sebastian Salgado oder gar die fürchterliche Diane Airbus. Wäre ich Maler, würde ich gern mit der problemlosen Klarheit eines Ingres arbeiten, den innerlichen Qualen eines Bacon. Ich habe es mit dem Malen versucht und bin gescheitert; und habe doch nicht aufgegeben. Ich habe mir gesagt, daß die Kamera der Pinsel unserer Zeit ist, bin hier, um einen Auftrag zu erfüllen, und doch auch aus anderem Grund – vielleicht mit einer Vorahnung.
Ich stand früh auf, um Zeit für mein Projekt zu haben, bevor das Filmteam bei den Wandbildern Diegos eintraf. Es war sechs Uhr an einem Februarmorgen. Ich war auf die Dunkelheit gefaßt, hatte mit ihr gerechnet. Daß sie sich aber derartig hinzog, machte mich nervös.
»Wenn Sie einkaufen wollen, wenn Sie ins Kino wollen, das Hotel hat eine Limousine, um Sie hinzubringen und wieder abzuholen«, sagten sie mir an der Rezeption.
»Das Einkaufszentrum ist zwei Straßenecken von hier«, antwortete ich halb erstaunt und halb ärgerlich.
»Wir übernehmen keine Verantwortung«, erklärte der Empfangschef mit einem affektierten Lächeln seines Dutzendgesichts. Wenn der Ärmste geahnt hätte, daß ich weiter wollte, viel weiter als bis zum Einkaufszentrum. Ich sollte, ohne es zu wissen, bis mitten in die Hölle der Trostlosigkeit gelangen. Ich lief schnell, ließ die Gruppe der Wolkenkratzer zusammengeschart hinter mir, wie eine Konstellation von Spiegeln – eine neue mittelalterliche, gegen den Ansturm der Barbaren geschützte Stadt –, und nach kaum zehn, zwölf Häuserblocks hatte ich mich in einem dunklen, ausgebrannten, mit Abfallkrusten gesprenkelten Ödland verirrt.
Bei jedem Schritt, den ich tat, streckte ich die Hand aus, um mich vorzutasten – wegen der andauernden Dunkelheit aufs Geratewohl, denn meine Kamera war mein einziges Auge, ich ein moderner Polyphem, der das rechte Auge an das Monokel der Leica drückte, das linke blind geschlossen hielt. Manchmal stolperte ich, dann wieder versank ich mit den Füßen in etwas Unsichtbarem, das ich nur riechen konnte, wie ein Polizeihund. Langsam drang ich tiefer und tiefer in eine Nacht ein, die einfach nicht aufhören wollte, sondern sich selbst immer neu gebar. In Detroit erwächst die Nacht aus der Nacht.
Für einen Augenblick ließ ich die Kamera auf die Brust sinken, spürte den dumpfen Schlag der Blende gegen mein Zwerchfell, und mein Eindruck bestätigte sich: Was mich umgab, war nicht die sich bis in den Wintermorgen hineinziehende Nacht und auch nicht, wie mir meine Phantasie vorgegaukelt hatte, die ruhelose Gefährtin des Tages, jene immer neu entstehende
Weitere Kostenlose Bücher