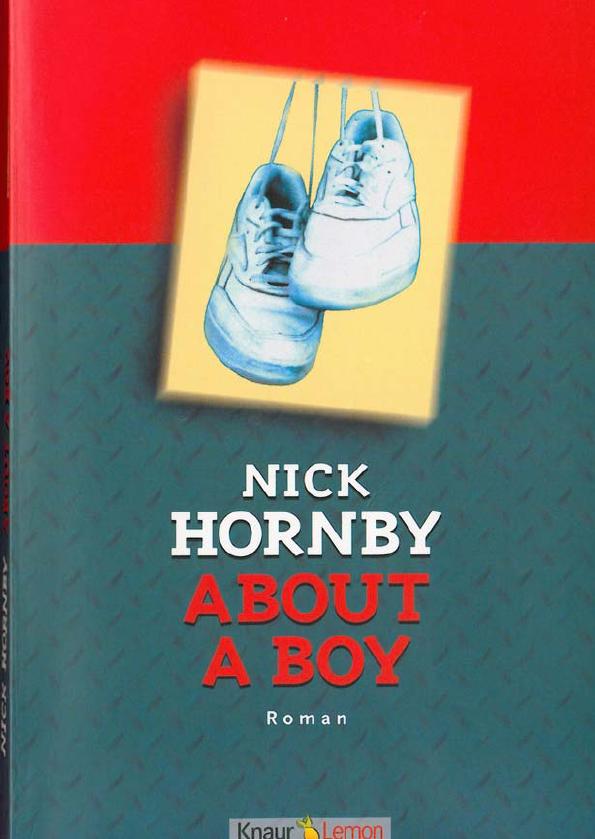![About a Boy]()
About a Boy
weg. Er konzentrierte seine Konversationsbemühungen auf Christine. »Und wie geht’s dir so, Chris?« »Ach, du weißt schon. Ein bisschen ausgelaugt.«
»Schwer über die Stränge geschlagen?« »Nein. Nur ein Baby zur Welt gebracht.«
»Oh. Stimmt ja.« Alles lief wieder auf das Drecksbaby hinaus. »Das kann einen ganz schön müde machen, schätze ich.« Er hatte bewusst eine Woche gewartet, um nicht über solche Dinge sprechen zu müssen, aber es hatte ihm nichts genützt. Sie redeten trotzdem darüber.
John kam mit einem Tablett und drei Bechern Tee herein. »Barney ist heute bei seiner Großmutter«, sagte er, ohne dass Will einen Grund dafür sehen konnte.
»Wie geht es Barney?« Barney war zwei, so ging es Barney, und darum war er für niemanden außer für seine Eltern interessant, doch auch hier schien man aus unerfindlichen Gründen eine Bemerkung von ihm zu erwarten.
»Es geht ihm prächtig, danke«, sagte John. »Natürlich ist er im Moment ein richtiger Satansbraten, und er weiß nicht genau, was er von Imogen halten soll, aber … er ist süß.« Will hatte Barney kennen gelernt und wusste mit Sicherheit, dass Barney nicht süß war, also beschloss er, diese absurde Feststellung zu ignorieren. »Und wie geht es dir, Will?« »Mir geht es gut, danke.«
»Immer noch keine Sehnsucht nach einer eigenen Familie?«
Lieber würde ich eine von Barneys verschissenen Windeln es
sen, dachte er. »Noch nicht«, sagte er.
»Du machst uns Sorgen«, sagte Christine.
»Ich fühle mich ganz wohl so, danke.«
»Das mag ja sein«, sagte Christine selbstgefällig. Die beiden machten ihn langsam körperlich krank. Es war schlimm genug, dass sie überhaupt Kinder hatten; warum hatten sie den Wunsch, diesen ersten Fehler zu verschlimmern, indem sie ihre Freunde anspornten, ihrem Beispiel zu folgen? Will war seit einigen Jahren überzeugt, dass man sein Leben leben konnte, ohne sich so ins Unglück zu stürzen wie John und Christine (und er war sicher, dass sie unglücklich waren, auch wenn sie in einen unheimlichen, indoktrinierten Zustand geraten waren, der sie für ihr eigenes Elend blind machte). Man brauchte Geld, sicher - das Einzige, was dafür sprach, Kinder zu bekommen, war, dass sie für einen sorgen konnten, wenn man alt, zu nichts mehr zu gebrauchen und pleite war -, aber er hatte Geld, und das bedeutete, dass er dem Durcheinander, den Klopapier-Sofadecken und der Zwangsidee, Freunden einzureden, sie müssten sich ebenfalls ins Unglück stürzen, aus dem Weg gehen konnte. John und Christine waren mal ganz nett gewesen. Als Will noch mit Jessica zusammen war, waren sie ein paar Mal die Woche zu viert durch die Clubs gezogen. Jessica und Will hatten sich getrennt, als Jessica das frivole Lotterleben gegen etwas Solideres eintauschen wollte; Will hatte sie vermisst, vorübergehend, das Nachtleben hätte er allerdings mehr vermisst. (Sie trafen sich noch ab und zu mittags auf eine Pizza, und dann zeigte sie ihm Bilder von ihren Kindern und sagte ihm, er würde sein Leben verschwenden und wüsste gar nicht, was er verpasste, worauf er zu ihr sagte, darauf könne er gut verzichten, und dann sagte sie zu ihm, das würde ihn ohnehin überfordern, worauf er zu ihr sagte, er habe nicht vor, je herauszufinden, ob dem so sei oder nicht; danach saßen sie dann schweigend da und tauschten böse Blicke.) Jetzt, wo John und Christine Jessicas Weg in eine bessere Welt gegangen waren, hatte er keinerlei Verwendung mehr für sie. Er wollte weder Imogen sehen noch wissen, wie es Barney ging, er wollte nichts über Christines Müdigkeit hören, und mehr hatten sie mittlerweile nicht mehr zu bieten. Mit denen würde er sich nicht mehr abgeben, besten Dank.
»Wir haben uns gefragt«, sagte John, »ob du wohl Imogens Patenonkel werden möchtest?« Die beiden saßen mit so erwartungsfrohem Lächeln da, als müsse er im nächsten Moment aufspringen, in Tränen ausbrechen und sich trunken vor Glück eng umschlungen mit ihnen auf dem Teppichboden wälzen. Will lachte nervös auf.
»Patenonkel? Kirche und so? Geburtstagsgeschenke? Adop
tion, falls ihr bei einem Flugzeugabsturz umkommt?«
»Genau.«
»Ihr nehmt mich auf den Arm.«
»Wir glauben, dass du verborgene Tiefen hast«, sagte John. »Ah, aber die habe ich nicht. Ich bin wirklich so oberflächlich.«
Sie lächelten immer noch. Sie schnallten es nicht. »Hört mal. Ich bin wirklich gerührt, dass ihr gefragt habt. Aber ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Im Ernst.
Weitere Kostenlose Bücher