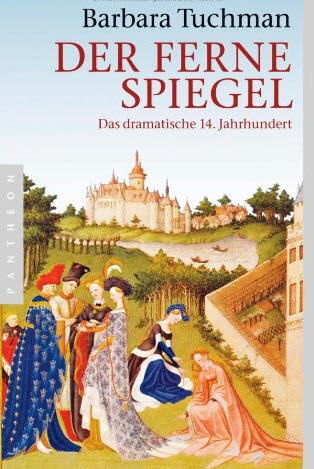![Der ferne Spiegel]()
Der ferne Spiegel
begann sie sich für die Folgen der Pest im späten Mittelalter zu interessieren. Wieder fand sie mit demselben Gespür für nachfühlbare Nähe den idealen schriftstellerischen Zugang: eine Hauptfigur, die, sieht man von der nördlichen Hälfte des Heiligen Römischen Reiches einmal ab, fast alle bedeutenden Schauplätze der damaligen Welt des 14. Jahrhunderts kennenlernt – und über die man trotz des fehlenden Porträts genügend weiß, um eine fesselnde Geschichte zu erzählen.
Enguerrand VII. (1340 bis 1397) ist nicht nur der letzte Spross
einer Dynastie, die über Generationen aus dem Dasein anrüchiger Warlords im Norden von Paris zu hochgeehrten Lehensmännern der französischen Könige aufgestiegen war. Er ist ein echter Ritter, der mit 15 Jahren das erste Mal ins Feld zieht, ja ein Weltmann, der den Hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich am eigenen Leibe erlebt: Sein Vater fällt in der Schlacht von Crécy 1346, und Coucy verbringt später als offizielle Geisel fünf Jahre in England; kurz vor seiner Rückkehr heiratet er Isabella, die ziemlich verschwenderische älteste Tochter des englischen Königs Edward III.
Rasch berühmt für seine strategischen Fähigkeiten, dient Coucy dann nicht nur auf etlichen Waffengängen seines Herrschers bis nach Nordafrika, er zieht auch auf eigene Rechnung gegen Österreich und das norditalienische Fürstenhaus der Visconti zu Felde. Verglichen mit anderen seines Standes, darf man ihn einen Intellektuellen nennen: So trifft er auch einmal Geoffrey Chaucer, Englands größten Dichter vor Shakespeare.
Meist aber hat der Tatmensch Coucy mit den Widrigkeiten seiner Zeit zu kämpfen. Er muss erleben, wie Pestwellen das Land veröden lassen und religiöse Hysterie hervorrufen. Ursprünglich Grundherr beiderseits des Kanals und ein Anwalt der Verständigung, wird er durch den Dauerkonflikt zwischen England und Frankreich 1377 zur Entscheidung gezwungen: Er tritt seine Besitzungen auf der Insel ab, verlässt den ehrwürdigen Kreis der Ritter des Hosenbandordens und trennt sich sogar von seiner Frau, die nach England zurückkehrt.
Ein Papst in Rom, sein Gegenpapst in Avignon, auf Frankreichs Thron ein König mit Wahnsinnsanfällen, im Osten der nahezu unaufhaltsame Vormarsch der Osmanen – je älter Coucy wird, desto bedrohlicher mehren sich apokalyptische Unheilszeichen. Als Teilnehmer an einem gesamteuropäischen Feldzug gegen die Türken, der mit einem militärischen Fiasko endet, das Coucy nicht zu verantworten hat, gerät er 1396 in Gefangenschaft des Sultans und stirbt wenige Monate später im kleinasiatischen Bursa.
Schon diese wechselvolle Lebensgeschichte könnte einen dicken Band füllen. Doch Barbara Tuchman geht es um mehr. Immer wieder gönnt sie sich – und das ist wohl der Kern ihres Erfolgsrezepts –
Abschweifungen, in denen alle Aspekte des spätmittelalterlichen Daseins virtuos ausgeleuchtet werden.
Wie etwa muss man sich das gewöhnliche Leben in Paris um diese Zeit vorstellen? Wandkamine waren der Luxus des Mittelstands, die Fußböden »wurden im Sommer mit duftenden Kräutern bestreut und im Winter mit Stroh, das in reichen Häusern öfter, in den armen nur einmal im Jahr gewechselt wurde. Private Räume gab es nicht, was die Gereiztheit der Menschen gesteigert haben mag. Auch in größeren Häusern schliefen die Gäste mit dem Gastgeber und seiner Frau in einem Raum.«
Mit solch handfesten Informationen ist das Buch gespickt. Hexenwahn, Klosterstiftungen, Bauernaufstände, pompöse Feste und Turniere, die ständige Angst vor den bewaffneten Horden der sogenannten Briganten, Kirchgang und Beichte (viel weniger regelmäßig, als spätere, verklärende Berichte es melden), dazwischen immer wieder verheerende Epidemiewellen: All diese Tatsachen ordnen sich zum Monumentalmosaik einer Zeit, in der die Autorin vielfach nackte »Verantwortungslosigkeit«, ja einen »bösen Geist« am Werk sieht. »Die Menschen fühlten sich wie Treibgut hin und her geworfen in einer Welt ohne Sinn und Richtung.«
So sehr dies der Grundton bleibt, es ist nicht vergessen, was der Kulturhistoriker Johan Huizinga 1919 in seinem bahnbrechenden Werk vom »Herbst des Mittelalters« wehmütig bestaunt hatte: Bildung, internationaler Geist und ein geradezu verschwenderisch reiches künstlerisches Leben entschädigten für die Schrecken des Alltags; Jenseitshoffnung und ostentative Daseinsfreude halfen über die Angst vor der Zukunft hinweg. Frauen spielten eine
Weitere Kostenlose Bücher