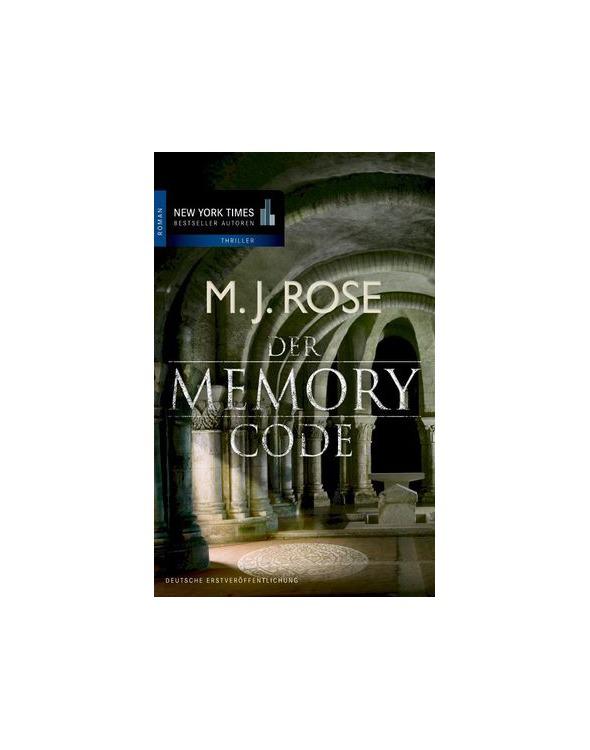![Der Memory Code]()
Der Memory Code
beirren.
“Ich glaube an etwas, das größer ist als wir, ja.”
Als sie auf das Kirchenportal zugingen, spürte Josh ungeachtet der warmen Temperaturen, wie er von einem eisig-bläulichen Nebel umhüllt und buchstäblich weggestoßen wurde. Es war genau das Gegenteil jener dunklen Macht, die ihn in Sabinas Grabkammer in den Stollen gesogen hatte.
Wie ein Blitz durchzuckte ihn die Erinnerung; ein stechender Schmerz jagte ihm quer über die Stirn zu den Schläfen, raste von dort um den Kopf und wieder zurück. Schlagartig wurde ihm klar: Vor seiner Einsegnung im Namen Jesu Christi war dieser Sakralbau ein völlig anderes Heiligtum gewesen.
19. KAPITEL
J ulius und Sabina
Rom – 391 nach Christus
Mit einer Eisenstange drosch der Soldat auf den Altar ein und hieb ihn derart in Stücke, dass ein Regen aus Marmorbrocken auf den Boden niederging. Einer davon schwirrte im Bogen durch die Luft und bohrte sich in Julius’ Fuß. Er achtete nicht darauf. Sein Blick verharrte wie gebannt auf dem Opferstein.
Was Jahrhunderte überdauert hatte, war nicht mehr. Einige Wimpernschläge lang stand alles wie gelähmt, sowohl die Soldatenhorde, die den Tempel angegriffen hatte, als auch die sechs Priester, die ihn zu verteidigen versuchten. Alle waren sie wie betäubt. Der Inbegriff des Gebetes seit ewigen Zeiten – dahin. Julius schaute hinüber zu Lucas, dem obersten Pontifex Maximus. In seinen Zügen stand die Realität geschrieben, die alle hinzunehmen hatten: Nichts und niemand war mehr sicher. Dies war bereits der zehnte Tempel, der in den vergangenen sechs Wochen verwüstet worden war.
Hinter sich vernahm Julius derbes Gelächter. Blindwütig wirbelte er herum und stürzte sich auf den Soldaten, der unter dem Aufprall aus dem Gleichgewicht geriet und taumelnd rückwärts stolperte. Einer seiner Kameraden hatte die Szene beobachtet und versetzte Julius einen Faustschlag ins Gesicht. Julius sackte in die Knie. Würgend vor Schmerzen musste er sich übergeben, direkt hier, mitten im Allerheiligsten.
Um ihn herum tobte Wutgebrüll und Gestöhn, das Knacken von Knochen, das Bersten von zerschmetterten Gelenken. Verzweifelt versuchte er, seine Sinne zu ordnen und die Augen zu öffnen, aber vergebens. Als er sein Gesicht befühlte, merkte er, dass seine Hand klebrig feucht war. Auch ohne hinzusehen wusste er, was es war, erkannte er den süßlichen Blutgeruch.
Linkerhand hörte er jemanden schreien. “Hinaus mit euch! Packt euch aus dem Tempel! Auf der Stelle! Habt ihr nicht schon genug angerichtet?”
Von der anderen Seite gehässiger Spott. “Heidengesindel! Ihr fahrt doch sowieso alle zur Hölle!”
Julius schmeckte Blut. Er rollte sich zur Seite, bemüht, zur Tempelwand zu gelangen, damit er sich abstützen und hochstemmen konnte.
“Wo sind die Tempeldirnen?”, grölte es unter anzüglichem Gelächter aus der Horde.
“Die jungfräulichen Dirnen! Bringt uns die Jungfrauen!”
“ Niemals !”
Zu seiner Überraschung stellte Julius fest, dass er inzwischen auf den Beinen stand und dass er es war, der da geantwortet hatte – ungeachtet der hämmernden Schmerzen in seinem Kopf. Benommen sah er, wie zwei der Soldaten auf ihn zukamen. Er wusste, er musste sich rechtzeitig wegducken; dann würden sie ihn vielleicht verfehlen und nur die Mauer treffen.
Als die beiden sich auf ihn stürzten, ließ er sich fallen und hörte im selben Moment über sich das Knacken der Knochen, gefolgt von Schmerzensschreien. Das Durcheinander ausnutzend, griff er einen der Eindringlinge von hinten an und rammte ihm die gespreizten Finger in die Augen.
Mit einem gellenden Kreischen fuhr der Geblendete herum und prallte dabei gegen einen gerade hinzueilenden Kameraden. Der stolperte über ihn und krachte mit dem Schädel gegen die scharfkantigen Reste des zerschlagenen Opfersteins. Vier aus der Horde außer Gefecht, noch drei weitere übrig – allmählich gewannen Julius und seine Brüder die Oberhand.
Mit dem Mute der Verzweiflung kämpfend, errangen sie schließlich den Sieg, doch als die Schlacht geschlagen war, da war der Boden blutüberströmt und übersät von Leichen. Den kleinen Triumph auszukosten, dazu war weder Ruhe noch Zeit. Heute waren es ihrer nur sieben gewesen; morgen würde der Feind in größerer Stärke anrücken. Den Priestern war klar, dass ihr Widerstand zwecklos sein musste, wenn es rein nach der Zahl ging. Ein paar Hundert Verteidigern stand eine kaiserliche Übermacht von Tausenden Soldaten
Weitere Kostenlose Bücher