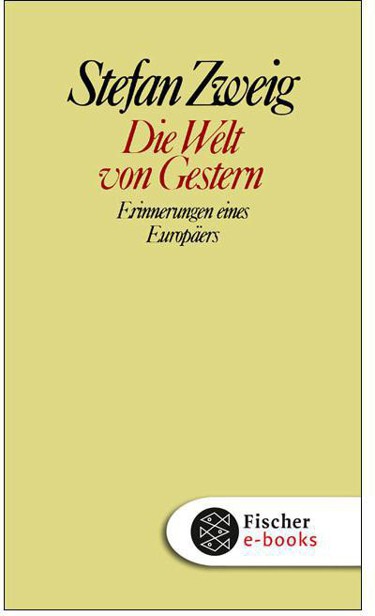![Die Welt von Gestern - Erinnerungen eines Europäers]()
Die Welt von Gestern - Erinnerungen eines Europäers
verlorenen Jahre – daß ich nicht früher an meine Aufgabe herangekommen bin. Wäre meine Gesundheit so gut wie mein Wille, dann stünde alles noch gut, aber Jahre kauft man nicht mehr zurück.« Ich begleitete ihn noch lange des Weges bis zu seinem Hause. Dort blieb er stehen und gab mir die Hand und sagte: »Warum kommen Sie nie zu mir? Sie haben mich nie zu Hause besucht. Telephonieren Sie vorher an, ich mache mich schon frei.« Ich versprach es ihm, fest entschlossen, das Versprechen nicht zu halten, denn je mehr ich einen Menschen liebe, desto mehr ehre ich seine Zeit.
Aber ich bin dennoch zu ihm gekommen, und schon wenige Monate später. Die Krankheit, die ihn damals zu beugen begann, hatte ihn plötzlich gefällt, und nur zum Friedhof mehr konnte ich ihn begleiten. Ein sonderbarer Tag war es, ein Tag im Juli, unvergeßlich jedem, der ihn miterlebte. Denn plötzlich kamen auf allen Bahnhöfen der Stadt, mit jedem Zug, bei Tag und Nacht, aus allen Reichen und Ländern, Menschen gefahren, westliche, östliche, russische, türkische Juden, aus allen Provinzen und kleinen Städten stürmten sie plötzlich herbei, den Schreck der Nachricht noch im Gesicht; niemals spürte man deutlicher, was früher das Gestreite und Gerede unsichtbar gemacht, daß es der Führer einer großen Bewegung war, der hier zu Grabe getragen wurde. Es war ein endloser Zug. Mit einemmal merkte Wien, daß hier nicht nur ein Schriftsteller oder mittlerer Dichter gestorben war, sondern einer jener Gestalter von Ideen, wie sie in einem Land, in einem Volk nur in ungeheuren Intervallen sich sieghaft erheben. Am Friedhof entstand ein Tumult; zu viele strömten plötzlich zu seinem Sarg, weinend, heulend, schreiend in einer wild explodierenden Verzweiflung, es wurde ein Toben, ein Wüten fast; alle Ordnung war zerbrochen durch eine Art elementarer und ekstatischer Trauer, wie ich sie niemals vordem und nachher bei einem Begräbnis gesehen. Und an diesem ungeheuren, aus der Tiefe eines ganzen Millionenvolkes stoßhaft aufstürmenden Schmerz konnte ich zum erstenmal ermessen, wieviel Leidenschaft und Hoffnung dieser einzelne und einsame Mensch durch die Gewalt seines Gedankens in die Welt geworfen.
Die eigentliche Bedeutung meines feierlichen Einlasses in das Feuilleton der ›Neuen Freien Presse‹ wirkte sich für mich im Privaten aus. Ich gewann dadurch eine unerwartete Sicherheit gegenüber meiner Familie. Meine Eltern befaßten sich wenig mit Literatur und maßten sich keinerlei Urteil an; für sie, wie für die ganze Wiener Bourgeoisie, war bedeutend, was in der ›Neuen Freien Presse‹ gelobt wurde, und gleichgültig, was dort ignoriert oder getadelt wurde. Was im ›Feuilleton‹ geschrieben stand, schien für sie durch höchste Autorität verbürgt, denn wer dort urteilte und richtete, forderte schon durch die bloße Position Respekt heraus. Und nun denke man sich eine solche Familie aus, die mit Ehrfurcht und Erwartung ihren Blick täglich auf dieses eine erste Blatt ihrer Zeitung richtet und eines Morgens unglaubhafterweise entdeckt, daß der ziemlich unordentliche Neunzehnjährige, der an ihrem Tisch sitzt, der in der Schule keineswegs exzelliert, und dessen Geschreibe sie mit Wohlwollen als ›ungefährliche‹ Spielereien hingenommen (besser immerhin als Kartenspiel oder Flirt mit leichtfertigen Mädchen), an dieser verantwortungsreichen Stelle zwischen den berühmten und erfahrenen Männern das Wort ergreifen durfte für seine (zu Hause bisher nicht sehr geachteten) Meinungen. Hätte ich die schönsten Gedichte Keats’, Hölderlins oder Shelleys geschrieben, so würde dies nicht eine so völlige Umstellung im ganzen Umkreis bewirkt haben; wenn ich ins Theater kam, zeigte man sich diesen rätselhaften Benjamin, der auf mysteriöse Weise in das heilige Gehege der Alten und Würdigen eingedrungen war. Und da ich öfters und beinahe regelmäßig in dem Feuilleton publizierte, geriet ich bald in Gefahr, eine angesehene lokale Respektsperson zu werden; dieser Gefahr entzog ich mich aber glücklicherweise rechtzeitig, indem ich eines Morgens meine Eltern mit der Mitteilung überraschte, ich wolle das nächste Semester in Berlin studieren. Und meine Familie respektierte mich oder vielmehr die ›Neue Freie Presse‹, in deren goldenem Schatten ich stand, zu sehr, um mir meinen Wunsch nicht zu gewähren.
Selbstverständlich dachte ich nicht daran, in Berlin zu »studieren«. Ich habe dort die Universität ebenso wie in Wien nur zweimal
Weitere Kostenlose Bücher