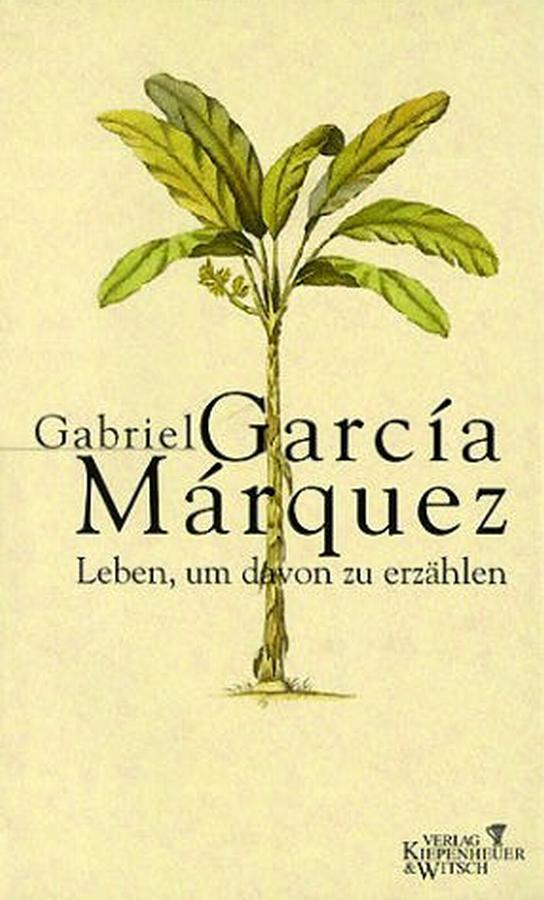![Leben, um davon zu erzählen]()
Leben, um davon zu erzählen
erbaut worden und hatten den gleichen provisorischen Charakter von Feldlagern. Ich erinnerte mich an all diese Orte mit der Kirche an der Plaza und den kleinen Häuschen wie aus dem Märchenbuch, in den Grundfarben gestrichen. Ich erinnerte mich an die Trupps schwarzer Tagelöhner, die in der Abenddämmerung sangen, an die Schuppen der Fincas, vor die sich die Landarbeiter setzten, um die Frachtzüge vorbeifahren zu sehen, an die Wege zwischen den Anpflanzungen, auf denen nach dem Samstagstrubel morgens enthauptete Macheteros lagen. Ich erinnerte mich an die Privatstädte der Gringos in Aracataca und Sevilla; jenseits der Bahngleise gelegen, waren sie wie riesige elektrifizierte Hühnerställe mit Maschendraht umzäunt, der an den kühlen Sommertagen morgens schwarz von verbrutzelten Schwalben war. Ich erinnere mich an Pfaue und Wachteln auf bedächtigen blauen Wiesen, an die Residenzen mit roten Dächern und vergitterten Fenstern, auf den Terrassen runde Tischchen und Klappstühle, wo man umgeben von Palmen und staubigen Rosenbüschen essen konnte. Manchmal waren durch den Drahtzaun schöne, schmachtende Frauen zu sehen, sie trugen Musselinkleider und große Gazehüte und schnitten mit goldenen Scheren die Blumen in ihren Gärten.
Schon in meiner Kindheit war es nicht leicht gewesen, die Ortschaften voneinander zu unterscheiden. Zwanzig Jahre später war es noch schwieriger, weil vom Portikus der Bahnhöfe die Schilder mit den idyllischen Namen abgefallen waren - Tucurinca, Guamachito, Neerlandia, Guacamayal -, zudem alles trostloser wirkte als in der Erinnerung. Der Zug hielt gegen halb zwölf Uhr vormittags fünfzehn endlose Minuten lang in Sevilla, wo man die Lokomotive auswechselte und Wasser tankte. Don begann die Hitze. Als die Fahrt wieder aufgenommen wurde, bescherte uns die neue Lokomotive bei jeder Kurve einen Schwall von Kohlenstaub, der in die scheibenlosen Fenster drang und uns mit schwarzem Schnee bedeckte. Der Priester und die Frauen waren, ohne dass wir es bemerkt hatten, an irgendeinem Ort ausgestiegen, und das verstärkte meinen Eindruck, dass wir allein in einem Niemandszug reisten. Meine Mutter saß vor mir, blickte aus dem Fenster, war zwei- oder dreimal eingenickt, wurde aber auf einmal munter und stellte mir ein weiteres Mal die gefürchtete Frage:
»Also, was sag ich nun deinem Papa?«
Ich dachte, sie würde auf der Suche nach einer Flanke, an der sie meine Entschlossenheit durchbrechen konnte, nie aufgeben. Kurz zuvor hatte sie Formeln für einen Kompromiss vorgeschlagen, die ich ohne Begründung ablehnte, wohl wissend, dass ihr Rückzug nicht von langer Dauer sein würde. Dennoch überraschte mich dieser neue Vorstoß. Auf eine weitere fruchtlose Schlacht vorbereitet, erwiderte ich ruhiger als die anderen Male:
»Sag ihm, ich will im Leben nur eins, ich will Schriftsteller sein, und ich werde es.«
»Er hat nichts dagegen, dass du das wirst, was du möchtest«, sagte sie, »vorausgesetzt, du schließt irgendein Studium ab.«
Sie sprach, ohne mich anzusehen, tat, als interessiere sie unser Gespräch weniger als das Leben, das am Wagenfenster vorbeizog.
»Ich weiß nicht, warum du derart insistierst, du weißt doch, dass ich nicht nachgeben werde«, sagte ich.
Sofort sah sie mir in die Augen und fragte verwundert:
»Warum glaubst du, dass ich das weiß?«
»Weil du und ich uns gleichen«, sagte ich.
Der Zug hielt an einer Bahnstation ohne Dorf und fuhr kurz darauf an der einzigen Bananenplantage vorbei, an deren Portal ein Name stand: Macondo. Das Wort war mir schon bei meinen ersten Reisen mit dem Großvater aufgefallen, doch erst als Erwachsener entdeckte ich, dass mir sein poetischer Klang gefiel. Ich hatte es nie wieder gehört, mich nicht einmal gefragt, was es bedeutete, es jedoch bereits in drei Büchern als Name für ein imaginäres Dorf verwendet, als ich zufällig in einer Enzyklopädie entdeckte, dass es sich um einen tropischen, der Ceiba ähnlichen Baum handelt, der weder Blüten noch Früchte entwickelt und dessen schwammiges Holz zum Bau von Kanus und zum Schnitzen von Küchengerät verwendet wird. Später entdeckte ich in der Encyclopaedia Britannica, dass es in Tanganjika den Nomadenstamm der Makondos gibt, und dachte, das könnte der Ursprung des Wortes sein. Dem bin ich aber nie nachgegangen, habe auch den Baum nie gesehen, weil mir keiner Auskunft geben konnte, obwohl ich in der Bananenregion oft danach gefragt habe. Vielleicht hat es den Baum nie gegeben.
Der
Weitere Kostenlose Bücher