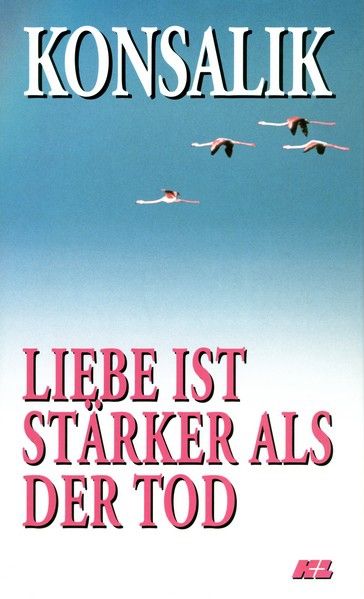![Liebe ist stärker als der Tod]()
Liebe ist stärker als der Tod
– mit reell gekauften Temperatuben. »Du bist ein Genie –« sagte sein väterlicher Freund immer wieder. Er hieß Jean-Claude, und das war genug. »Weißt du, was ein Genie ist? Die Menschen werden einmal deine Bilder kaufen und dich mit Geld zuwerfen! Das heißt, wenn sie nicht zu doof sind, dein Genie zu erkennen –«
Ein prophetisches Wort! Pierre konnte Jean-Claude später nicht mehr daran erinnern. In einem verdammt kalten Winter starb Jean-Claude an einer Lungenentzündung, durchaus bürgerlich in einem Krankenhausbett, für das Pierre (und für die Arztkosten) eine Wand der Hospitalkapelle ausmalte. Damals war er vierzehn Jahre alt, lang aufgeschossen und schmächtig, ein Gerippchen mit einem schwarzumlockten Kinderkopf und sehr wachsamen, alles sehenden und alles abschätzenden Augen.
Mit vierzehn, nach Jean-Claudes Tod, kam er auch zum erstenmal in die Schule, ein Findling, ein moderner Kaspar Hauser. Und in vier Jahren holte er nach, wozu andere neun lange Jahre brauchen. Das war in Concarneau, oben in der Bretagne, an der Küste des Atlantik.
Als Pierre de Sangries achtzehn war, malte er eine Madonna, die so aussah, wie seine Mutter ausgesehen haben mußte … ein Engel mit schwarzen langen Haaren und einem Blick, in dem die Liebe der ganzen Welt lag. Als er das Bild fertig hatte, saß er zwei Tage davor und weinte zum erstenmal wieder nach Jahren. Am dritten Tag verkaufte er die Madonna an den Direktor seiner Schule, bekam dafür große Worte und 50 Francs und verschwand aus der kleinen Stadt Concarneau.
Irgendwann tauchte er dann in Paris auf, bereicherte die Straßenmaler auf der Place du Tertre, wohnte mit vier anderen hungernden Malern zusammen in einem stinkenden Kellerzimmer auf dem Montmartre, porträtierte Touristen, vor allem Amerikaner, sparte das Geld und versoff es nicht oder steckte es den Huren zwischen die Brüste, sondern kaufte auf dem Flohmarkt ein gebrauchtes Fahrrad: Fifi.
Das war vor neun Jahren gewesen.
Paris war um ein Genie reicher geworden … aber Paris wußte es nicht.
Es wußte es bis heute nicht, diesen 3. September, an dem Pierre de Sangries sein neunzehnmal lackiertes Fahrrad an dem eisernen Geländer des Pissoirs an der Place de l'Etoile abstellte und im Fußgängertunnel verschwand.
*
Wer oben auf der Plattform des Arc de Triomphe steht und über Paris blickt, wenn das Sonnenlicht wie ein goldener Schleier über den Avenuen und Boulevards, den Alleen und Dächern, den Brücken und der Seine liegt, wenn er sieht, wie ein Stahlgigant wie der Eiffelturm plötzlich schweben kann, das Trocadéro zu einem Zauberschloß wird und Sacré-Coeur weit in der Ferne aus dem Himmel zu taumeln beginnt, der drückt die Hände auf sein Herz und wagt nicht mehr zu atmen. Was Schönheit ist, kann kein Wort erklären, kein Ton vermitteln, keine malende Hand aufzeichnen – es bleibt alles unvollkommen. Schönheit ist nur zu sehen, und Schönheit ist zu empfinden für den, der eine Seele dafür hat.
Pierre hatte seinen kleinen Klappstuhl vorn an der Brüstung der Plattform aufgebaut, seine Staffelei aufgeklappt, eine Leinwand darauf gestellt, die Palette und den Farbkasten griffbereit auf den Boden gelegt und saß nun in der Sonne mit der ihm bekannten Angst im Herzen, vor dieser geballten Schönheit um sich herum kapitulieren zu müssen.
»Ich werde es nie können –« sagte er und stemmte die Sohlen seiner Schuhe gegen die Brüstung. »Nie! Ich bin ein Stümper. Aber auch Stümper müssen leben. Fangen wir also an. Das übliche: Paris von oben in der Sonne. Ein Postkartenbild in Öl. Zum Kotzen –«
Er schob die Hände in die Hosentaschen, rührte sich nicht und starrte hinüber zu dem weißen, im Sonnenglast schwebenden Wunder Sacré-Coeur auf dem Montmartre-Hügel. Die Plattform des Arc de Triomphe war nur schwach besucht, die Schulklassen kamen erst gegen zehn, die Touristen noch später – es war eine herrliche Ruhe um ihn herum. Den brausenden Verkehr auf den Straßen hörte er nicht … hier oben war er wie ein geschlossenes Summen, kein Lärm, sondern etwas Unnennbares, das zu dieser Stadt gehörte. Ein Sonnengesang, würde der rote Henry sagen, aber so etwas fiel auch nur einem erfolglosen Dichter ein. Claude Puy, der rote Henry … Pierre lächelte verträumt. Neun Uhr vierzehn … um diese Zeit schlief Henry noch, nach Rotwein duftend und nach Weiberschweiß, und keiner löst das Rätsel, woher er für beides das Geld nimmt.
Plötzlich sah Pierre sie. Vor einer
Weitere Kostenlose Bücher