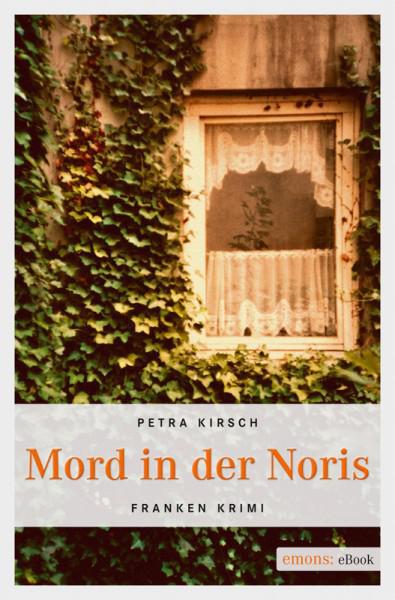![Mord in Der Noris]()
Mord in Der Noris
1
Sie wachte morgens um halb acht auf:
erschöpft, verkatert, mit Kopfschmerzen. Das würde heute ein böser Tag werden.
Halb schlafend, halb wach spürte sie, wie das Monster
von ihr Besitz ergriff. Dieser ungebetene Dauergast, ja dieser Stalker, der sie
seit einigen Wochen immer zur selben Zeit, in den ersten Sekunden nach dem
Aufwachen, überfiel. Aus dem Hinterhalt, aufdringlich und übermächtig.
Unbeherrschbar, das ängstigte sie. Von Tag zu Tag mehr. Das Einzige, womit sie
ihn einigermaßen im Zaum halten konnte, war: sofort aufstehen, sich den
Alltagsverrichtungen widmen, keinen Leerlauf in Taten und Gedanken zulassen.
Missmutig stieg sie aus dem Bett und schlurfte in die Küche.
Dort schaltete sie die Kaffeemaschine ein, sah auf die
Kaiserburg, die sich vor ihrem Küchenfenster erstreckte – sonst ein Anblick,
den sie immer genoss und dessentwegen sie diese simpel geschnittene
Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon und ohne Fenster im Bad gekauft hatte. Heute,
wie schon in den vergangenen Wochen, spendete ihr die prächtige Kaiserstallung
allerdings keinen Trost. Heute war sie nur irgendein Gemäuer, nichtssagend,
grau, trist und vor allem – uralt.
Sie angelte sich die große Tasse aus dem Spülbecken,
in dem sich das benutzte Geschirr von zwei Tagen stapelte, goss sich Kaffee ein
und murmelte halblaut Richtung Küchenuhr: »Drecksgeburtstag.«
Paula Steiner, Kriminalhauptkommissarin in den
Diensten des Polizeipräsidiums Mittelfranken, neunundvierzig, ledig und auch
sonst ohne jedes Talent für ein ausgefülltes Familien- oder Sozialleben, hatte
derzeit nur eine Sorge, und das war ihr unaufhaltsam näher rückender
fünfzigster Geburtstag, das Monstrum, das einer Planierraupe gleich alles
niederwalzte, was das Leben an Annehmlichkeiten und Vergnügungen für sie
bereithielt. In zehn Tagen war es so weit. Dann würde sie von einem Tag auf den
anderen in einer anderen, einer in ihren Augen deutlich minderwertigeren Liga
spielen. Dann könnte sie auf Fragen nach ihrem Alter, die sie in letzter Zeit
mehr und mehr als eine dreiste Zumutung, gar als eine Ungezogenheit empfand,
nicht mehr mit einem vagen »Ende vierzig« antworten. Dann wäre der Abstand zu
ihren beiden Mitarbeitern – der blutjungen, gerade mal fünfundzwanzig
gewordenen Eva Brunner und dem in ihren Augen ebenfalls ausgesprochen juvenilen
vierunddreißigjährigen Heinrich Bartels – noch, ja vielleicht nicht größer,
aber augenfälliger, deutlicher auf jeden Fall.
Zu all diesem Übel kam hinzu, dass sie sich den
unvermeidlichen Gratulanten würde stellen müssen. Zumindest im Präsidium. Das
erwartete man von ihr, wie sie selbst das bisher von ihren Kollegen bei runden
Geburtstagen auch erwartet hatte. Ein hausinterner Brauch, den sie heute,
während sie grübelnd unter der Dusche stand, das erste Mal gründlich in Frage
stellte: Warum eigentlich musste das so sein? Genügte es nicht, dass man sich
an diesem Tag von etwas Liebgewonnenem unwiderruflich verabschieden musste? Das
war doch kein Grund zum Feiern, eher für das Gegenteil: Es war ein Grund, sich
einzuigeln, sich zu verkriechen und zu hoffen, dass dieses einschneidende Datum
möglichst unbemerkt von der Außenwelt vorüberging. Sie nahm sich vor, gleich
heute noch für eine entsprechende Klarstellung im Kollegenkreis zu sorgen: Eine
wie auch immer geartete Feier würde es von ihrer Seite nicht geben; desgleichen
würde sie sich Geschenke oder Gratulationen, egal ob persönlich oder
schriftlich, mit allem Nachdruck verbitten.
Gedankenschwer verließ sie kurz darauf die Wohnung und
überquerte den Vestnertorgraben, ohne wie sonst die Kaiserburg, das ihrer
Ansicht nach schönste Gebäude ihrer Heimatstadt Nürnberg, mit einem
bewundernden Blick zu würdigen. Erst als sie zügigen Schrittes den Hauptmarkt
hinter sich gelassen hatte und in die Kaiserstraße abgebogen war, blieb sie
unvermittelt stehen.
Irgendetwas war an diesem Dienstag anders als sonst.
Irgendetwas Neues lag in der Luft. Es dauerte eine Weile, bis Paula Steiner
darauf kam, was dieses Etwas war: Heute schien nach einem kalten, langen und
harten Winter der erste Tag in diesem Jahr zu sein, an dem es weder regnete
noch schneite. Sie sah zum Himmel. Keine Wolken, kein ewiges Grau-in-Grau,
heute spannte sich über ihr dieses perfekte monochrome Blau, nach dem sie sich
in den vergangenen Wochen so gesehnt hatte.
Noch immer war es kühl und kahl, aber das Vermanschte
und Abgenutzte, das Feuchte und Fahle der vergangenen
Weitere Kostenlose Bücher