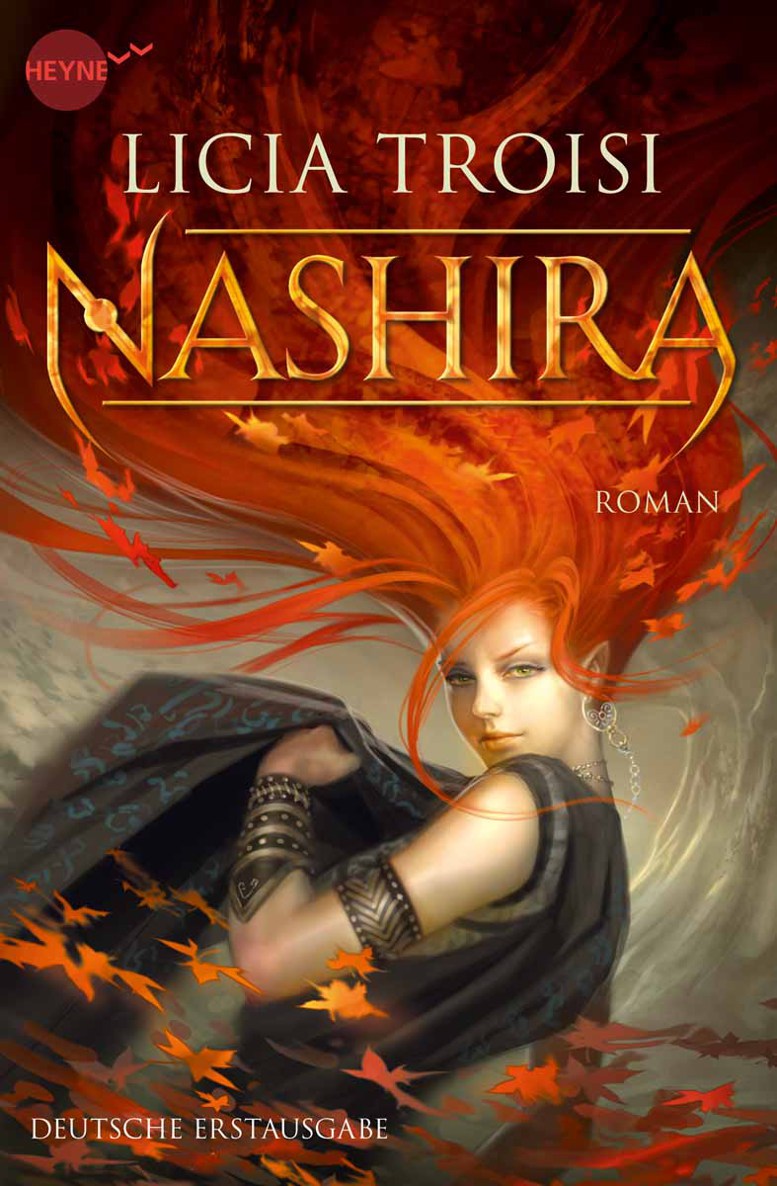![Nashira]()
Nashira
gewechselt, bei einem dritten hat dem Aufseher an diesem Morgen ganz einfach sein Gesicht nicht gepasst. Und weißt du, was das Seltsamste ist? Dass ich nichts daran finde.«
»Dann geh morgen besser nicht zur Arbeit. Wir können dich vielleicht auch irgendwie verstecken.«
Talitha beugte sich zu ihm vor. »Du verstehst mich nicht richtig. Wir müssen weg. Auf der Stelle«, sagte sie.
Saiph seufzte. »Du hast Recht. Das hier sollte eine vorübergehende Lösung sein. Mittlerweile ist schon zu viel Zeit vergangen.«
Talitha schüttelte den Kopf. »Es ist ja nicht deine Schuld, aber in der ganzen Zeit habe ich nichts von dem Ketzer gehört: Also hat es keinen Sinn, noch länger zu bleiben. Aber anstatt darüber nachzudenken, wie wir hier wegkommen, habe ich den Kopf gesenkt und gehorcht. Genau das, was ich nicht mehr tun wollte.« Saiph schaute sie an, und sie las in seinem Blick genau die Trägheit, die auch sie überkommen
hatte. »An diesem Ort geht mir das verloren, was mir geholfen hat, mich vom Kloster zu befreien: die Kraft, Ungerechtigkeiten nicht einfach hinzunehmen, mich zur Wehr zu setzen. Wir sind auch geflohen, um das Geheimnis um Cetus aufzudecken und Nashira zu retten. Aber alles, was uns stark machte, wurde uns ausgetrieben, und übriggeblieben ist nur die Angst. Heute habe ich wieder den Mann gesehen, der mir das Schwert gestohlen hat, und es hat mich kalt gelassen. Völlig kalt. Verstehst du?«
Saiph wandte den Blick ab. »Wir versuchen doch nur zu überleben.«
»Aber wie! Ich bin den ganzen Tag allein dort draußen und mache nichts anderes als Eisblöcke verpacken. Das ...«, sagte sie und trommelte dabei mit dem Zeigefinger auf der Tischplatte, »... ist noch viel schlimmer als das Kloster.«
»Gut, dann hauen wir eben wieder ab.«
»Ja, sicher, aber ich will auch nichts tun, was wir später bitter bereuen. Hast du eine Idee, wie wir vorgehen könnten?«
Saiph fuhr sich nervös mit den Händen durch die Haare. »Nein, überhaupt nicht. Mein Kopf ist völlig benebelt, ich kann nicht mehr richtig denken. Mir fehlt die Kraft zu fliehen, ich hab keine Lust mehr, immer auf der Flucht zu sein.«
Talitha blickte ihn lange an.
»Ich höre sie jeden Tag, Saiph, deine Brüder, ich lebe jeden Tag mit ihnen, und jetzt kann ich sie verstehen. Ich verstehe, warum sie deinen Namen flüstern, obwohl es verboten ist, ich verstehe, warum sie dich alle anstrahlten, als wir mit ihnen zusammensaßen: Du bist ihre einzige Hoffnung.«
Saiph machte eine wegwerfende Handbewegung. »Du glaubst, so eine Revolution sei etwas Schönes, etwas Heroisches,
du glaubst, dass diese Leute, weil sie unterdrückt werden, immer das Recht auf ihrer Seite haben. Aber das stimmt nicht. Revolution bedeutet Blut und Tränen, und dass auch Unschuldige getötet werden. Jeder Aufstand wird mit kriegerischen Mitteln geführt, und im Krieg gibt es immer nur Verlierer. Natürlich stimmt es, wir Femtiten werden unterdrückt und die Talariten sind wie Bestien zu uns, aber auch wir können gemein und grausam sein. Wir an eurer Stellen würden uns keinen Deut anders verhalten, aber genau davon träumen wir: euren Platz einzunehmen.«
»Du hast bloß Angst«, erwiderte Talitha entrüstet.
»Nein, ich bin bloß realistisch. Ich verstehe, wie schlecht du dich fühlst, und glaub mir, ich empfinde genauso, denn ich habe mir das Leben auch anders vorgestellt. Aber verlange nicht von mir, all diese Leute in eine Revolte zu führen. Das kann ich nicht. Ich kann keine Idee über alles andere stellen, über das Leben von Unschuldigen, über die Unterscheidung zwischen Richtig und Falsch. Das ist nicht meine Art. Aber das ist auch nicht von Bedeutung. Wir werden fortgehen.«
Talitha wünschte ihm eine gute Nacht und ging in den anderen Raum hinüber. Saiph blieb noch einen Augenblick reglos am Tisch sitzen, den Kopf in die Hände gestützt.
Direkt vor Hergats Hütte löste jemand sein Auge von einem Schlitz zwischen zwei schiefen Brettern und entfernte sich eilig.
Noch ganz verschlafen stand Talitha im Morgengrauen auf. Der Streit vom Vorabend hatte sie aufgewühlt und nicht schlafen lassen. Plötzlich schien ihr alles unerträglich, selbst
die Kammer, in der sie zu dritt schliefen, und Dynaers schwerer Leib im Bett neben ihr.
Sie rieb sich ein paarmal die Augen, bevor sie sich daranmachte, wieder die weiße Paste auf das Gesicht aufzutragen. Lange würde sie nicht mehr reichen. Die Menge, die sie zubereitet hatten, nahm rasant ab.
Und wo
Weitere Kostenlose Bücher