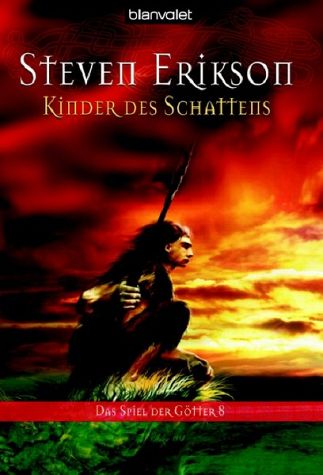![SdG 08 - Kinder des Schattens]()
SdG 08 - Kinder des Schattens
könnt.«
»Ist es Klugheit, das Leben aus Euren Augen zu nehmen und die Schärfe aus Euren Gedanken? Ist es Klugheit, die Euch gleichgültig gegenüber dem alptraumhaften Wunder macht, dessen Zeugen wir gestern geworden sind?«
»Ganz recht. Was sollte es denn sonst sein?«
»Vielleicht Verzweiflung?«
»Und was habe ich, das der Verzweiflung würdig wäre?«
»Ich bin wohl kaum der richtige Mann, um diese Frage zu beantworten.«
»Das stimmt …«
»Aber ich werde es dennoch versuchen.« Er holte eine Feldflasche aus der Tasche, zog den Stöpsel und setzte sie an. Zwei schnelle Schlucke, dann seufzte er und lehnte sich zurück. »Es ist mir aufgefallen, dass Ihr ein empfindsamer Mensch seid, Freisprecherin, was vermutlich für jemanden mit Eurer Aufgabe von Vorteil ist. Aber Ihr seid nicht in der Lage, das Geschäftliche von allem anderen zu trennen. Empfindsamkeit ist im Grunde eine alles durchdringende Art von Verletzlichkeit. Sie macht es anderen leicht, Euch wehzutun, sie sorgt dafür, dass die Narben, die Ihr tragt, sich schon beim kleinsten Stich wieder öffnen und erneut bluten.« Er nahm einen weiteren Schluck; der hochprozentige, mit weißem Nektar vermischte Alkohol ließ sein Gesicht allmählich schlaff werden, und als er weitersprach, war auch seine Aussprache nicht mehr so deutlich wie zuvor. »Hull Beddict. Er hat Euch weggestoßen, aber Ihr kennt ihn zu gut. Er stürmt blindlings voran. In ein Schicksal, das er sich selbst erwählt hat, und es wird ihn entweder umbringen oder zerstören. Ihr wollt irgendetwas dagegen tun, ihn vielleicht sogar aufhalten, aber Ihr könnt es nicht. Ihr wisst nicht, wie Ihr das anstellen sollt, und das betrachtet Ihr als Euer Versagen. Euren Fehler. Eine Schwäche. Und daher habt Ihr Euch entschieden, nicht ihn für das Schicksal verantwortlich zu machen, das ihm zustoßen wird, sondern Euch selbst. Und warum auch nicht? Es ist einfacher so.«
Irgendwann im Verlauf von Buruks Vortrag hatte sie beschlossen, auf den bitteren Bodensatz in dem Becher zu starren, den sie in den Händen hielt. Jetzt wanderten ihre Blicke über den angeschlagenen Rand zu ihren Daumen und Fingern, die von fleckigem, rissigem Leder umhüllt waren. Die abgeflachten Ballen waren glänzend und dunkel, die Nähte ausgefranst, die Knöchel gedehnt und knorrig. Irgendwo da drinnen waren Haut, Fleisch, Muskeln, Sehnen und Schwielen. Und Knochen. Hände waren so außerordentliche Werkzeuge, dachte sie. Werkzeuge und Waffen, ungeschickt oder gewandt, taub oder empfindsam. Bei Stammesjägern konnten sie sprechen, ein Wirbel aus Gesten, beredt in der Stille. Aber schmecken konnten sie nicht. Oder hören. Oder weinen. Aus all diesen Gründen töteten sie so leicht.
Während vom Mund Laute ausgingen, die so geformt waren, dass ihre Bedeutung erkennbar war – Leidenschaft, Schönheit, blendende Klarheit. Oder getrübt und leise schneidend, mörderisch und böse. Manchmal alles zugleich. Sprache war Krieg, weitreichender als alle Schwerter, Speere und Zauberei. Das Selbst, das einen Kampf gegen alle anderen führte. Grenzen verordnete, verteidigte, Ausfälle und Durchbrüche ausführte, Schlachtfelder voller Leichen, die verfaulten wie herabgefallene Früchte. Worte, die im wilden Getümmel stets nach Verbündeten, nach einer Wahrscheinlichkeit suchten, die festen Regeln unterworfen war.
Und ihr wurde klar, dass sie müde war. Sie war all dieser Dinge müde. Frieden herrschte in der Stille, innen wie außen, in Abgeschiedenheit und Erschöpfung.
»Warum sagt Ihr nichts, Freisprecherin?«
Er saß allein da, ohne ein Wort zu sagen, einen Bärenfellumhang um die Schultern gelegt, das Schwert mit der Spitze nach unten zwischen seinen goldumkleideten Füßen, die lange, streifige Klinge und das Heft mit dem glockenförmigen Handschutz vor sich. Irgendwie hatte er es geschafft, die Augen zu öffnen, und in den verschleierten Schatten unter seiner Stirn war ein Glitzern zu sehen, eingerahmt von wachsbedeckten Zöpfen. Seine Atemzüge wurden von einem leisen Rasseln begleitet, das einzige Geräusch, das in dem großen Raum nach dem langen, gestelzten Wortwechsel zwischen Tomad Sengar und Hannan Mosag noch zu hören war.
Das letzte Wort war verklungen, und geblieben war ein Gefühl tief empfundener Hilflosigkeit. Kein einziger der aberhundert anwesenden Edur rührte sich oder sagte etwas.
Tomad konnte nichts mehr im Namen seines Sohns vorbringen. Irgendeine schleichende Macht hatte seine Autorität
Weitere Kostenlose Bücher