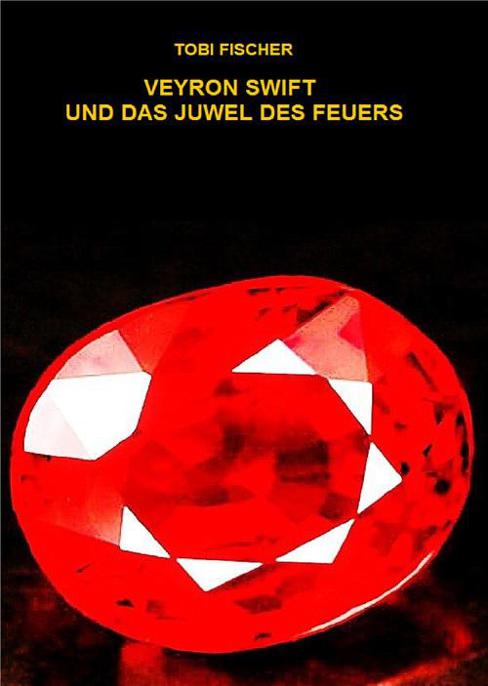![Veyron Swift und das Juwel des Feuers]()
Veyron Swift und das Juwel des Feuers
Tom Packard
»Wie um alles in der Welt bin ich nur hierhergekommen, wie um alles in der Welt konnte mir das passieren?« fragte sich Tom Packard. Er saß im örtlichen Polizeirevier und wartete auf sein Verhängnis, das an diesem 14. Juli des Jahres 2011 zweifellos Jugendheim bedeuten würde. Sie steckten ihn bestimmt in ein Heim, ausgerechnet ihn!
Tom war gerade einmal vierzehn Jahre alt und ein Durchschnitts-Teenager, weder zu groß noch zu klein, weder zu dick noch zu dünn. Lediglich seine rotblonden Strubbelhaare und seine grünen Augen hoben ihn ein wenig aus der Masse.
Der Raum war ziemlich klein, mit jedem Augenblick schienen die vergilbten Wände näherzukommen. Es gab nur ein einziges Fenster, einen alten Schreibtisch und zwei schwarze Bürostühle. Immerhin war es kein Vernehmungszimmer – das war schon einmal ein gutes Zeichen – sondern ein Warteraum. Die Polizisten hatten ihn für den Moment allein gelassen, um ihm etwas zum Trinken zu holen. Kaum waren sie fort, hatte er heimlich die Tür geöffnet. Nur einen Spalt weit, weil er wissen wollte, was draußen vor sich ging. Immerhin steckte er in einer ernsten Lage. Niemand schien es zu bemerken und so vernahm er die Stimmen der Beamten relativ deutlich.
Sie sprachen über den Tod seiner Eltern.
Es stimmte, er war jetzt ein Waise. Vor einem halben Jahr starben seine Mom und sein Dad bei einem Verkehrsunfall. Er saß damals in der Schule, als die Polizisten kamen und ihn aus der Klasse holten. Da er ansonsten in England keine lebenden Verwandten hatte (er wusste nur von einen entfernten Onkel in Australien), musste er zu Priscilla Evans ziehen, der Stiefschwester seiner Mutter. Priscilla war bloß zehn Jahre älter als er und mit der Betreuung eines Heranwachsenden vollkommen überfordert. Zumindest waren sich die Polizisten draußen auf dem Flur dessen sicher.
»Dieser Frau kann man doch kein Kind anvertrauen! Ständig wechselnde Jobs, ein mickriges Einkommen, jede Menge Schulden!« hörte er gerade einen der Polizisten sagen.
Genau deswegen war er hier gelandet! Priscilla war verschwunden, einfach abgehauen. Sie hatte ihn allein gelassen.
Von Kümmern konnte man gar nicht reden, sie versuchte ihm sogar soweit es ging aus dem Weg zu gehen. Früher einmal, da hatte er sie nett gefunden, als die Welt noch in Ordnung gewesen war und sie hin und wieder zu Besuch kam. Doch mit dem Tod seiner Eltern änderte sich alles. Es hatte schon mit dem Tag begonnen, als man ihn zu ihr schickte. Mit seiner Trauer ließ sie allein, nicht ein einziges Mal fand sie ein tröstendes Wort. Er hatte öfter ihren Rücken gesehen als ihr Gesicht und wenn er sie einmal ansprach, kam sie mit Ausflüchten. Sie hätte jetzt keine Zeit zum Reden und müsse gleich weg – oder irgendetwas dergleichen.
Den ganzen Haushalt hatte sie ihm aufgehalst. Waschen, Kochen, Putzen, Einkaufen. Priscilla kümmerte sich wirklich um nichts!
Sie wohnte in einer schäbigen, engen Wohnung im achten Stock eines Hochhauses in Londons Stadtteil Ealing. Der Boden knarzte bei jedem Schritt, die Wände waren inzwischen grau und hätten dringend einen frischen Anstrich benötigt. Durch die alten Fenster blies der Wind, obwohl sie geschlossen waren. Im Bad roch es nach Schimmel, in seinem Zimmer nach Moder.
Kein Wunder also, dass sie, als sein Vormund, schließlich sein Erbe veräußerte. Darunter das Haus seiner Eltern und alles andere, was sich irgendwie zu Geld machen ließ. Priscilla bezahlte damit irgendwelche Schulden, Tom wusste es nicht genau. Am Ende blieb jedenfalls nichts mehr übrig. Vor einer Woche war sie dann auf einmal verschwunden; einfach abgehauen. Sie hatte alles aus der Wohnung mitgenommen, was sich in zwei Koffer quetschen ließ. Als Tom von der Schule nach Hause kam, fand er die Wohnung weitgehend geräumt vor.
Natürlich hinterließ ihm Priscilla keine Nachricht und auch die kommenden drei Tage hörte er nichts von ihr. Zunächst machte sich Tom Sorgen, doch allmählich verwandelte sich dieses Gefühl in Wut und Bestürzung. In der Schule hatte er sich nichts anmerken lassen und geglaubt, seine Sache recht gut gemacht zu haben. Als jedoch sein eh schon mageres Taschengeld zuneige ging und die Nahrungsmittel knapp wurden, flog seine Tarnung schließlich auf. Lehrer stellten unbequeme Fragen, Mitschüler bedachten ihn mit skeptischen Blicken.
»Ja, es ist fast ein Wunder, dass er nicht auf die schiefe Bahn geraten ist«, hörte er gerade eine Polizistin sagen. Sie hatte
Weitere Kostenlose Bücher