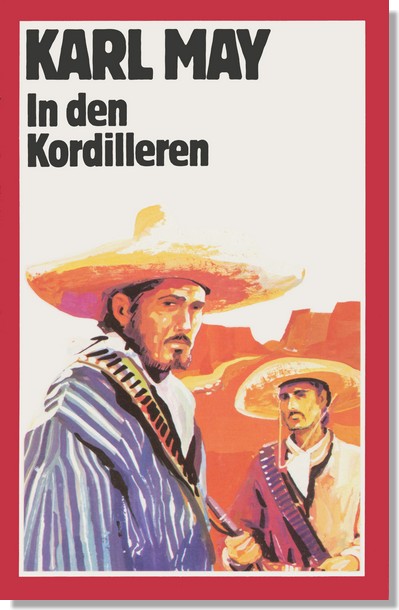![35 - Sendador 02 - In den Kordilleren]()
35 - Sendador 02 - In den Kordilleren
besitzen.“
„Ist es nicht schrecklich, Menschen zu überfallen, um sie zu töten oder sie mit in die Wildnis zu schleppen, um sie später gegen hohes Lösegeld freizugeben?“
„Ja, das ist schrecklich, Señor. Aber wer tut das? Wer hat es zuerst getan? Wer hat uns diese Weise der Kriegsführung gezeigt?“
„Die Weißen etwa?“
„Sie glauben es nicht? Nun, so denken Sie doch an das gegenwärtige Beispiel! Der Sendador führt eine ganze, große Gesellschaft Weißer über den Paraná. Die Leute wollen an den Rio Salado, welcher uns gehört. Sie wollen in unserem Gebiet wohnen und auf demselben Yerba suchen und die Wälder niederschlagen, die uns gehören und ohne welche wir nicht leben können. Ist das nicht Überfall? Haben sie uns um die Erlaubnis gefragt? Werden sie uns das bezahlen, was sie uns nehmen, den Fluß, die Wälder, die Yerba, die Bäume? Nein! Und wenn wir uns sträuben, uns berauben zu lassen, so greifen sie nach ihren Waffen und wenden Gewalt an. Wie viele von uns dabei getötet werden, das erzählen sie nicht. Und wenn sie je davon sprechen, so rühmen sie sich dessen. Habe ich recht oder nicht, Señor?“
Ich zögerte mit der Antwort, denn ich konnte ihm nicht Unrecht geben. Dann fuhr er fort:
„Wenn Sie also von Raub und Mord sprechen, so klagen Sie die Weißen an, aber nicht uns. Sie sind die Angreifer, während wir uns nur verteidigen.“
„Aber verteidigt man sich durch die Entführung von Frauen und Mädchen?“
„Ja, wenn einem sonst kein Mittel übrig bleibt.“
„Sie haben andere Mittel, Ihre Waffen.“
„Das können Sie sagen, weil Sie fremd im Lande sind. Die Weißen haben Gewehre, Pulver und Patronen. Wir aber besitzen nur Spieße und Pfeile, mit denen wir gegen sie nichts vermögen. Muß es da nicht unser Bestreben sein, auch Gewehre zu erhalten?“
„Freilich wohl.“
„Nun, kaufen können wir sie uns nicht, denn wir haben kein Geld. Die Weißen haben uns das gute Land weggenommen, so daß wir weder Estanzias noch Ranchos besitzen. Wir können uns nichts verdienen. Darum nehmen wir, wenn sich uns Gelegenheit dazu bietet, die Frauen und Töchter der Weißen gefangen und geben sie ihnen gegen ein Lösegeld zurück, für welches wir uns dann kaufen, was wir brauchen.“
„Aber die Männer und Knaben tötet ihr bei solchen Gelegenheiten!“
„Sollen wir sie leben lassen, da sie uns bei der nächsten Veranlassung umbringen würden? Wir handeln nur aus Rücksicht für unsere Verteidigung so. Wollen Sie den Schaden, welchen die Weißen erlitten haben, vergleichen mit den Verlusten, die sie uns zufügten, so werden Sie zu der Erkenntnis kommen, daß wir sehr im Nachteil sind.“
„Da kommen Sie auf ein eigenartiges Thema. Ich glaube nicht, daß Sie ahnen, welchen Schaden nur in den La Plata-Staaten die Indianer anrichten. Die Indianer dieses Landes haben während der letzten fünfzig Jahre ungefähr elf Millionen Rinder, zwei Millionen Pferde und ebensoviele Schafe gestohlen. Dabei sind dreitausend Häuser zerstört und fünfzigtausend Menschen getötet worden.“
„Señor, glauben Sie das doch nicht!“
„Ich muß es glauben, denn es ist berechnet worden!“
„Das haben die Indianer nicht getan. Die Weißen sind die größten Spitzbuben. Was sie selbst tun, dafür klagen sie uns an. Wenn ein Weißer Pferde stiehlt, so sind wir es gewesen. Wenn ein Weißer den andern ermordet, so sind wir die Mörder. Die Hälfte, wenigstens die Hälfte dessen, wovon Sie jetzt sprachen, haben Weiße verschuldet. Und wenn diese Leute an ihren eigenen Genossen so handeln, wie mögen sie sich da gegen uns verhalten! Nein, Señor, was Sie da vorbringen, das spricht mehr zu unseren Gunsten als zu unserem Schaden.“
„Hm! Ich hörte allerdings schon Ähnliches äußern.“
„So hat man Ihnen die Wahrheit gesagt. Man sendet Soldaten gegen uns aus, angeblich um die Ansiedler gegen unsere Raubzüge zu schützen. Aber ich sage Ihnen, daß die größten Räuber sich unter den Grenzsoldaten befinden. Und wenn die Zahlen, welche Sie vorhin brachten, die volle Wahrheit enthielten, so wäre der Schaden, welchen die Weißen uns verursacht haben, doch viel größer. Das ganze Land gehörte uns. Was darauf lebt und wächst, ist also unser Eigentum. Wenn ich mir ein Rind, ein Pferd fange, so stehle ich nicht etwa, sondern ich nehme nur das, was mir gehört.“
So sagen alle südamerikanischen Indianer. Sie sind überzeugt, ganz in ihrem Recht zu sein, und niemand kann ihnen das
Weitere Kostenlose Bücher