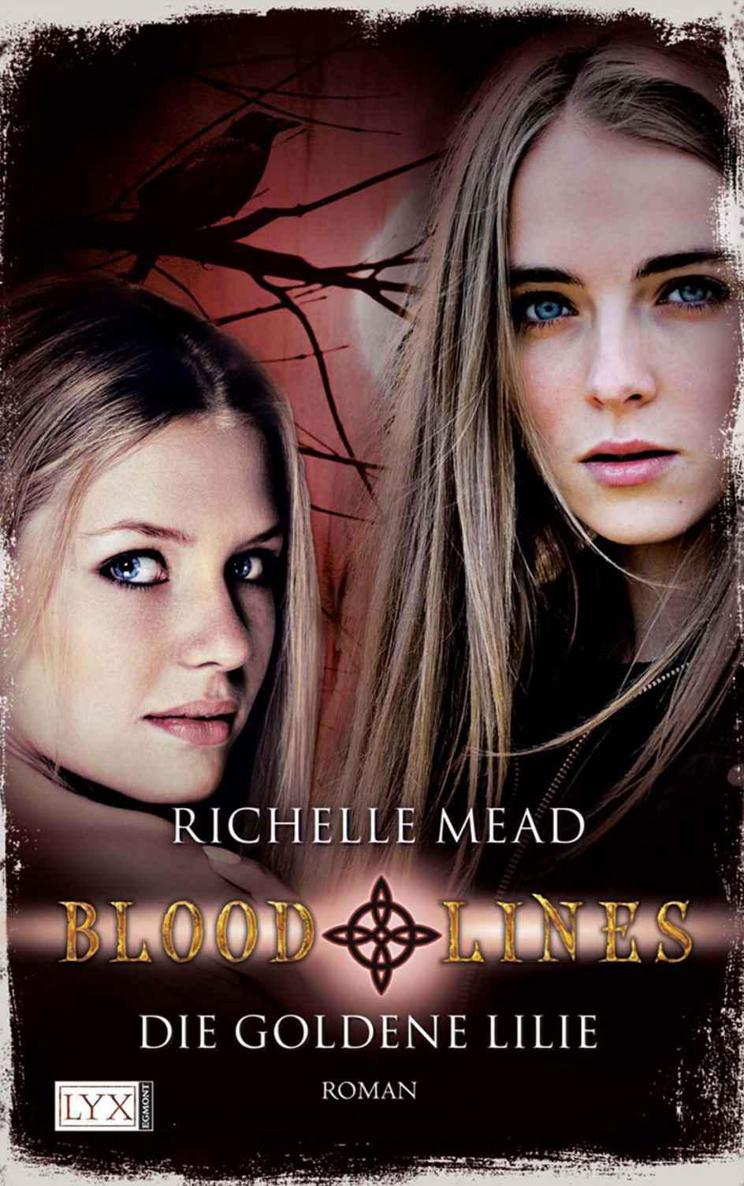![Bloodlines: Die goldene Lilie (German Edition)]()
Bloodlines: Die goldene Lilie (German Edition)
sicher und unbemerkt verlassen, bevor sich die Magie abnutzt.«
Die Worte waren nicht an mich verschwendet, und trotz meines inneren Widerstrebens musste ich einfach fragen: »›Fast unmöglich?‹«
»Es funktioniert nicht, wenn Ihre Gegner tatsächlich wissen, dass Sie da sind«, erläuterte sie. »Sie können ihn nicht einfach weben und unsichtbar werden – obwohl es dafür fortgeschrittenere Zauber gibt. Aber wenn jemand nicht bewusst damit rechnet, dass Sie da sind … nun, dann sieht er Sie auch nicht.«
Sie zeigte mir andere, und viele davon waren elementar, beruhten auf Amuletten und erforderten ein ähnliches Mittel zur Aktivierung. Einer, den sie als mittelschwer bezeichnete, beruhte auf einem umgekehrten Prozess. Die Zauberin trug ein Amulett, das siebeschützte, während sie den Rest des Zaubers wob. Dadurch wurden alle Leute in einem gewissen Umkreis vorübergehend blind. Nur die Zauberin konnte weiterhin sehen. Zwar hörte ich ihr zu, aber ich wand mich innerlich bei dem Gedanken, durch Magie direkt auf einen anderen einzuwirken. Es war eine Sache, sich zu verbergen. Aber jemanden zu blenden? Ihn benommen zu machen? Ihn zu zwingen einzuschlafen? Durch den Einsatz falscher und unnatürlicher Mittel, um Dinge zu tun, die Menschen nicht tun durften, wurde eine Grenze überschritten.
Und dennoch … tief im Innern musste ich mir die Nützlichkeit des Ganzen eingestehen. Der Überfall hatte dazu geführt, dass ich alles Mögliche in einem anderen Licht sah. So schmerzlich es auch sein mochte, ich konnte sogar einsehen, dass es vielleicht nicht gar so schlimm war, Sonya Blut zu geben. Vielleicht. Bereit dafür war ich noch auf keinen Fall.
Ich hörte geduldig zu, während sie das Buch durchging, und fragte mich die ganze Zeit über, was sie hier eigentlich für ein Spiel trieb. Als schließlich nur noch fünf Minuten Zeit blieben, sagte sie: »Für nächsten Montag sollen Sie einen dieser Zauber nachstellen, genauso wie bei dem Feueramulett. Zudem sollen Sie ein Protokoll darüber schreiben.«
»Ms Terwilliger … «, setzte ich an.
»Ja, ja«, sagte sie, klappte das Buch zu und stand auf. »Ich bin mir über Ihre Argumente und Einwände vollauf im Klaren, dass es Menschen nicht bestimmt sei, solche Macht zu besitzen und all diesen Unfug. Ich respektiere Ihr Recht, so zu empfinden. Niemand zwingt Sie, etwas davon auch anzuwenden. Sie sollen bloß weiter ein Gefühl für die Herstellung bekommen.«
»Ich kann es nicht«, beharrte ich. »Ich werde es nicht.«
»Es ist nichts anderes als das Sezieren eines Frosches in der Biologie«, argumentierte sie. »Hand ans Werk, um das Material zu verstehen.«
»Vermutlich … «, gab ich verdrossen zu. »Welchen soll ich denn herstellen, Ma’am?«
»Das liegt ganz bei Ihnen.«
Etwas an dieser Antwort störte mich noch mehr. »Es wäre mir lieber, wenn Sie einen aussuchen würden.«
»Seien Sie nicht dumm«, erwiderte sie. »Sie haben bei Ihrer gesamten Hausarbeit die Freiheit, und Sie haben die Freiheit auch bei dieser Entscheidung. Es ist mir gleich, was Sie tun, solange die Arbeit vollständig ist. Nehmen Sie sich vor, was Sie interessiert!«
Und genau das war das Problem. Indem sie mich wählen ließ, zwang sie mich, mich mit der Magie zu beschäftigen. Es war leicht für mich, keinen Anteil daran zu haben und darauf hinzuweisen, dass alles, was ich tat, unter Zwang geschah. Selbst wenn sie mir diese Arbeit praktisch diktierte, zwang sie mich dadurch, dass ich diese eine kleine Entscheidung treffen musste, die Initiative zu ergreifen.
Also zögerte ich die Entscheidung hinaus – was ich bei Hausaufgaben eigentlich noch nie getan hatte. Ein Teil von mir dachte, dass sich die Aufgabe, wenn ich sie unbearbeitet ließe, in Luft auflösen oder dass Ms Terwilliger ihre Meinung ändern würde. Außerdem hatte ich eine Woche Zeit. Kein Grund, deswegen jetzt schon Stress zu machen.
Obwohl ich wusste, dass wir Lia für die Kostüme nichts schuldig waren, hatte ich trotzdem das Gefühl, dass es richtig wäre, sie ihr zurückzugeben – nur damit kein Zweifel an meinen Absichten bestehen konnte. Sobald mich Ms Terwilliger gehen ließ, packte ich mein Kostüm und das von Jill in die Kleidersäcke und machte mich auf den Weg ins Stadtzentrum. Zwar war Jill traurig, ihres herzugeben, räumte aber ein, dass es richtig so war.
Lia sah das jedoch anders.
»Was soll ich mit diesen Kleidern?«, fragte sie, als ich in ihrem Geschäft auftauchte. Sie trug Ohrringe mit
Weitere Kostenlose Bücher