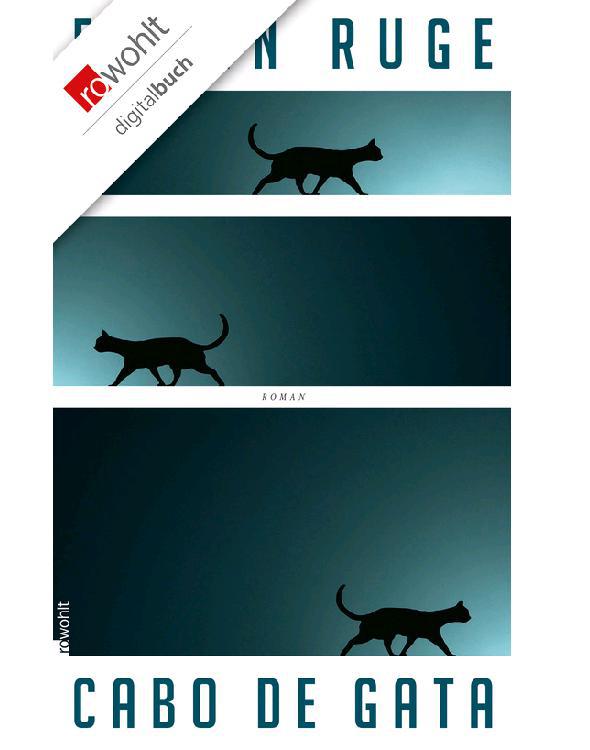![Cabo De Gata]()
Cabo De Gata
rechts in die Rambla ein, um in der nächsten oder übernächsten Querstraße das kleine Hotel zu suchen, das der spanische Reiseführer, den ich am Ostbahnhof gekauft hatte, als preiswert empfahl. Das Hotel hieß, glaube ich, Maritim , es befand sich im zweiten oder dritten Stock eines schwülstigen Gründerzeithauses. Hinter einer ebenso schwülstigen Wohnungstür stieß man auf eine Art Rezeption, eigentlich nur eine Theke, an der ein dicklicher Mann mittleren Alters sein Leben zu fristen schien. Sein Gesicht hatte die Farbe von Pflanzentrieben, denen das Tageslicht fehlt, seine Bewegungen waren schlangengleich, und sein Spanisch klang in meinen Ohren wie abfließendes Spülwasser. Er zeigte mir ein schmales, dunkles Zimmer, das sich bei näherer Betrachtung als Segment eines ehemals großzügigen Raumes erwies, das man durch eine Sperrholzwand abgetrennt hatte. An der Zimmerdecke sah man die brutal unterbrochene Stuckleiste. Das Zimmer kostete 1500 Pesetas, also etwa 18 Mark, und ich erinnere mich, dass ich sofort auszurechnen begann, wie lange mein Geld reichen würde, wenn ich hier bliebe.
Nachdem ich mein Gepäck abgestellt hatte, trat ich wieder hinaus auf die Rambla. Es muss gegen zehn Uhr morgens gewesen sein. Die Sonne wärmte schon, der Himmel war blau. Ich fühlte mich wunderbar leicht ohne Rucksack. In meinem Reiseführer hatte ich gelesen, das schöne Wort Rambla bedeute ursprünglich ausgetrocknetes Flussbett , und ich weiß noch, dass mir diese kleine etymologische Wendung sofort das Gefühl gab, orientiert zu sein, ein wenig von der Topographie der Innenstadt zu verstehen, die um dieses ehemalige Flussbett herum gewachsen zu sein schien.
Wie in jeder fremden Stadt begann ich sofort nach dem Besonderen, Abweichenden im Stadtbild zu suchen, nach dem typisch Barcelonischen. Ich erinnere mich an die zahlreichen Zeitungskioske, die sich, während ich vorbeiging, einer nach dem anderen entfalteten wie gigantische Schmetterlingslarven. Ich erinnere mich an Blumenverkäufer, die ihre Ware auf dem Gehweg auszubreiten begannen, an Bäuerinnen, die Käfige mit lebenden Hühnern aufeinanderstapelten. Ich erinnere mich an einen blinden Losverkäufer, der inmitten der Buntheit in einem telefonzellengroßen Häuschen saß und den Geldschein einer Kundin mit beiden Daumen und Zeigefingern befühlte.
Im Reiseführer hatte ich auch gelesen, dass es hier, auf dem Pflaster der Rambla, ein Miró-Mosaik zu besichtigen gab, und obwohl ich zugeben muss, dass ich mich nur mäßig für Miró interessiere, begann ich danach zu suchen, zuerst beiläufig, dann mit zunehmender Unrast. Mehrmals pendelte ich zwischen der Plaza de Colon und der Plaza de Catalunya hin und her, aber die Wahrscheinlichkeit, den Miró zu finden, wurde immer geringer: Mit jedem Mal war das Pflaster weiter zugestellt, die Rambla wurde immer voller, das Gedränge größer. Touristen in kurzen Hosen tauchten auf. Plötzlich waren überall Stände, an denen irgendwelcher Plunder verkauft wurde: sogenannte Souvenirs oder irgendwelche vermutlich in Vietnam gefertigten Textilien, und nachdem ich zum soundsovielten Mal an einem der auf dem Pflaster ausgebreiteten Blumenteppiche vorbeigegangen war, kniete ich nieder, um den Verdacht, der in mir aufstieg, prompt bestätigt zu finden: Die Blüten waren geruchlos.
Ich verließ die Rambla, marschierte eine Zeitlang durch die Altstadt, schaute mir sogenannte Sehenswürdigkeiten an, von denen ich nichts mehr weiß, im Grunde noch nicht einmal, dass ich sie sah. Das Einzige, woran ich mich erinnere, sind die blinden Losverkäufer, die plötzlich überall waren und die mir jetzt vorkamen wie Sklaven einer mächtigen, kriminellen Organisation; und ich erinnere mich an die Unruhe im Innern, die ich gleichsam aus der erfolglosen Suche nach dem Miró-Mosaik forttrug, die mich durch die alten Straßen und Gassen trieb, als würde ich noch immer nach etwas suchen. Irgendwann aß ich in einem Restaurant in der Nähe der Markthalle Bacalao, angeblich ein Nationalgericht: versalzener Fisch in dunkler Mehlschwitze. Danach schlief ich eine Stunde in der Sonne auf einer Bank und machte mich dann wieder auf den Weg – jetzt zur Kathedrale von Gaudí, der größten, berühmtesten Barcelonas, an der, wie mein Reiseführer mit merkwürdigem Stolz berichtete, seit über hundert Jahren gebaut werde, weil sie nur durch Spenden und Stiftungsgelder finanziert sei.
Ich weiß nicht mehr, ob die Kathedrale geschlossen hatte oder ob ich
Weitere Kostenlose Bücher