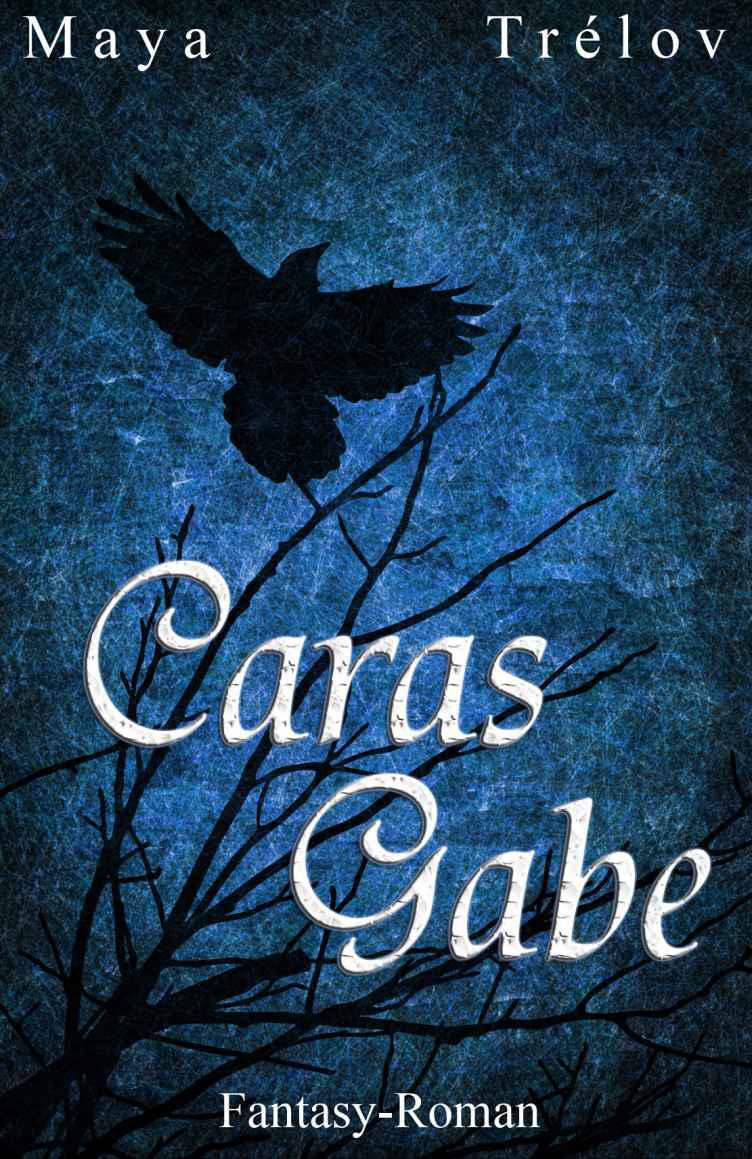![Caras Gabe]()
Caras Gabe
Lurians Worte nichts bedeuten.
„Es tut mir leid, Cara, aber es gibt etwas, worum du dich kümmern solltest.“
Der Ton in seiner Stimme bringt mich dazu aufzublicken.
„Komm“, sagt Lurian und reichte mir seine Hand. „Ich führe dich hin.“
Wenig später stehen wir über einem Abgrund im Inneren des Berges. Unsere Blicke senken sich auf das Verlies unter uns, dessen Gefangene durch ein Eisengitter von uns getrennt sind.
Die Abneigung auf Lurians schönem Gesicht ist unverkennbar. „Was soll mit ihnen geschehen?“, fragt er.
Ich blicke auf die Lichtträger in der Grube hinab. Ihre Augen sind nicht mehr groß und glänzend wie Spiegel, nun kann ich den Schmerz und die Angst darin lesen. Sie drängen sich aneinander wie verschreckte Kinder und für einen quälenden Moment kann ich nichts anderes in ihnen sehen als das: Weisen, deren Vater ermordet wurde.
„Sperr sie ein“, sage ich kalt. „Fern von allem Licht. Ich kann ihren Anblick nicht ertragen.“
Lurian nickt grimmig. „Nur zu gerne.“
„Und noch etwas.“
Der Engel sieht mich erwartungsvoll an.
„Ich will, dass sie niemals wieder diesen Berg verlassen.“ Marmon war hier gefangen, ich kann den Berg nicht verlassen und ihnen soll es nicht anders ergehen. „Niemals.“
Ich schließe mich in meinen Gemächern ein und versuche die Gesichter der Lichtträger aus meinem Gedächtnis zu vertreiben. Ihre Blicke, ihre verdammten Blicke verfolgen mich. Sie haben zu mir aufgeschaut und mir vertraut, bloß weil ich ihre Herrin bin, ihr heiliges Licht, anbetungswürdig in ihren Augen. Sie verstehen es nicht, dass ich sie bestrafe, ebenso wenig wie ein Hundewelpe es versteht, wenn man nach ihm tritt. Wie können Wesen, die so grausam und gefühllos gegenüber den Menschen sind, mich ansehen, als hätte ich sie verraten?
Ich schlage meine Faust mit aller Gewalt gegen die Wand. Blendender Schmerz durchzuckt mich. Ich keuche vor Pein, sinke gegen die Wand und presse die Hand an meinen Körper.
Meine Beine geben unter mir nach. Ich breche auf dem weichen Teppich zusammen und plötzlich spüre ich gar keinen Schmerz mehr. Es ist vielmehr die Abwesenheit von jeglichen Gefühlen, die mich so sehr ins Wanken gebracht hat. Nur in der Ferne höre ich ein Tosen und Dröhnen. Mir ist, als säße ich in einer Talsenke in den Bergen, der sich eine gewaltige Lawine nähert. Ich kann sie nicht sehen, nur hören und spüren. Bald wird sie hier sein.
Mit offenen Augen liege ich da und starre auf die roten Teppichfasern. Die Lawine wird mich überwältigen, mich unter sich begraben und mitreißen.
Ich weiß nicht, wie lange ich so daliege, nur, dass ich es irgendwann leid bin. Ich bin es leid, mein eigenes Leid zu ertragen. Ich komme auf die Füße, taumele zum Fenster und stoße es auf. Kühle Luft strömt mir entgegen und für einen Moment schaffe ich es, alles um mich zu vergessen und einzig den Duft von Frost und Schnee, das Heulen des Windes um den Berg und die Gänsehaut zu spüren, die sich über meine nackten Arme ausbreiten. Ich stütze die Hände auf das Fensterbrett und starre in die Tiefe. Wie bin ich nur hierhergekommen? An dieses Fenster, das sich so sehr von dem unterscheidet, hinter dem ich geboren worden und aufgewachsen bin?
Es kommt mir vor, als hätte ich erst gestern das Gesicht zur Nacht gereckt und die tastenden Finger eines Dämons in meinem Haar gespürt, seine geflüsterten Worte an meinem Ohr.
Der Wunsch, den ich nach dem Tod meines Vaters auf einer glitzernden Münze in die Finsternis geschleudert habe, ist zu mir zurückgekehrt, doch nun ist er wertlos. Marmon ist besiegt, die weißen Priester sind geflohen, die Lichtträger zerstört oder gefangen. Doch meine Rache ... ist wertlos.
Ich fasse nach einer Glasscherbe. Tropfen um Tropfen hellgelben Blutes quellen aus meiner Haut und fallen aufs Fensterbrett. Ich sehe teilnahmslos dabei zu. Das dunkle Verlies meines altes Zimmers ist gegen einen Käfig aus Gold getauscht worden.
Ich fasse die Scherbe fester, um das Wort auf meinem Unterarm zu vollenden. Mehr Blut tropft auf das Fensterbrett. „Niemals.“
Die Tür quietscht in meinem Rücken, doch ich sehe nicht einmal auf. Dann höre ich Schritte.
„Cara! Was tust du da?“ Kurz darauf ist Lurian neben mir, entwindet mir die Scherbe und schleudert sie aus dem Fenster.
Ich schenke Lurian keine Beachtung. Ich sehe ihn kaum. Es gibt nur ein einziges Gesicht, das vor meinem geistigen Auge schwebt wie ein Geist, der mich heimsucht.
Weitere Kostenlose Bücher