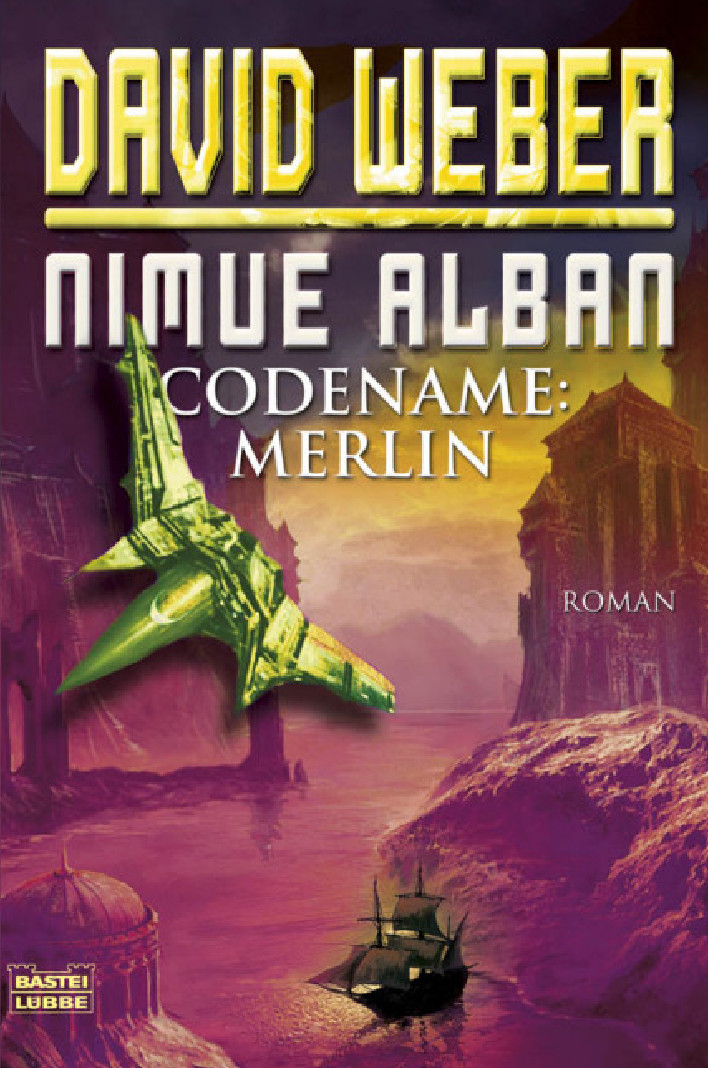![Codename Merlin - 3]()
Codename Merlin - 3
weit aufgerissen, als sei er allen Ernstes überrascht, dass selbst Charisianer es wagen sollten, Mutter Kirche derart zu beleidigen. Und vielleicht war er es auch tatsächlich. Sawal hingegen musste feststellen, dass es ihn selbst nicht im Mindesten überraschte.
»Ja, das hat er«, stimmte ihm der Unterpriester deutlich ruhiger zu, als er sich eigentlich fühlte.
Ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, dass sie es tun würden, dachte er. Und warum überrascht mich das hier dann nicht? Das ist der Anfang vom Ende der Welt, um Gottes willen!
Erneut dachte er über die Depeschen nach, die er mit sich führte: an wen sie gerichtet waren, und auch warum. Er dachte an die Gerüchte, die allmählich die Runde machten, was genau sich Prinz Hektor und seine Verbündeten eigentlich erhofft hatten … welche Belohnungen ihnen die Kirche versprochen hatte.
Nein, nicht die Kirche, ermahnte sich Sawal selbst. Die Ritter der Tempel-Lande. Es gibt da sehr wohl einen Unterschied!
Und so sehr er sich selbst das auch einzureden versuchte, er wusste es besser. Welcher technische oder rechtliche Unterschied zwischen diesen beiden Dingen auch existieren mochte, Pater Sawal wusste es besser. Und das, so begriff er jetzt zu seinem eigenen Entsetzen, war auch der Grund dafür, dass er über die Entwicklung hier eigentlich nicht überrascht war.
Selbst jetzt konnte er es nicht einmal für sich selbst in Worte fassen, er brachte es nicht über sich, sich dieser Erkenntnis zu stellen, doch er wusste es. Was auch immer ›die Wahrheit‹ gewesen sein mochte, vor diesem gewaltigen Angriff, den Prinz Hektor und seine Verbündeten gegen das Königreich von Charis geführt hatten: Die Charisianer wussten genauso gut wie Sawal, wer in Wahrheit dahinter gesteckt hatte. Sie alle wussten, welche zynischen Überlegungen man angestellt hatte, wie bereit man gewesen war, nahezu beiläufig das Blut eines ganzen Volkes zu vergießen und dabei alles in Schutt und Asche zu legen, und sie wussten auch, welche Arroganz diese Angreifer erfüllt und inspiriert hatte. Dieses Mal hatte sich die ›Vierer-Gruppe‹ zu weit aus den Schatten herausgewagt, und das, was sie als ein einfaches kleines Attentat auf ein unliebsames Königreich angesehen hatten, hatte sich zu etwas völlig anderem entwickelt.
Charis wusste sehr wohl, wer schon die ganze Zeit über der eigentliche Feind gewesen war, und das erklärte auch genau, warum dieser Schoner hier bereit war, das Feuer auf ein Schiff zu eröffnen, das unter der Flagge von Gottes Eigener Kirche fuhr.
Der Schoner war ihnen jetzt noch näher gekommen, er krängte unter den gewaltigen Segelmassen; vor ihrem Bug schien das weiße Wasser zu kochen, im Sonnenlicht schimmerte die Gischt zahllosen schwebenden Edelsteinen gleich in allen Farben des Regenbogens. Mittlerweile konnte Sawal einzelne Besatzungsmitglieder sehen, die sich hinter das niedrige Schanzkleid kauerten; er erkannte auch den Captain in seiner Uniform: Dort stand er, achtern, nahe dem Steuer. Und gleichzeitig sah Sawal, wie die Geschützbedienung die vorderste Kanone der Steuerbord-Breitseite nachlud. Der Kommandant blickte zu seinen eigenen Segeln auf, dann betrachtete er erneut die Anmut, mit der dieser Schoner über die Wellen dahinglitt wie ein gewaltiger Kraken. Sawal holte tief Luft.
»Streichen Sie die Flagge, Bruder Tymythy«, sagte er.
»Pater?« Bruder Tymythy starrte ihn an, als könne er nicht glauben, was er soeben gehört hatte.
»Streichen Sie die Flagge!«, wiederholte Sawal mit festerer Stimme.
»Aber, der Bischof-Vollstrecker …«
»Streichen Sie die Flagge!«, fauchte Sawal.
Einen Augenblick hatte der Kommandant des Schiffes den Eindruck, Tymythy wolle diesen Befehl verweigern. Schließlich kannte Sawals Stellvertreter die Anweisungen ebenso gut wie er selbst. Doch natürlich fiel es einem Bischof ungleich leichter, einem Unterpriester den Befehl zu erteilen, ›um jeden Preis‹ die Autorität von Mutter Kirche zu wahren. Schließlich müsste dazu nicht er selbst, sondern eben Pater Rahss Sawal die gesamte Besatzung seines Schiffes in den Tod führen − in einer nutzlosen, völlig vergeblichen Schlacht.
Wenn auch nur die geringste Hoffnung für uns bestünde, unsere Depeschen doch noch abzuliefern, würde ich die Flagge nicht streichen lassen, sagte er zu sich selbst, und gleichzeitig fragte er sich, ob das tatsächlich die Wahrheit war. Aber es ist ganz offensichtlich, dass wir vor ihnen nicht fliehen können,
Weitere Kostenlose Bücher