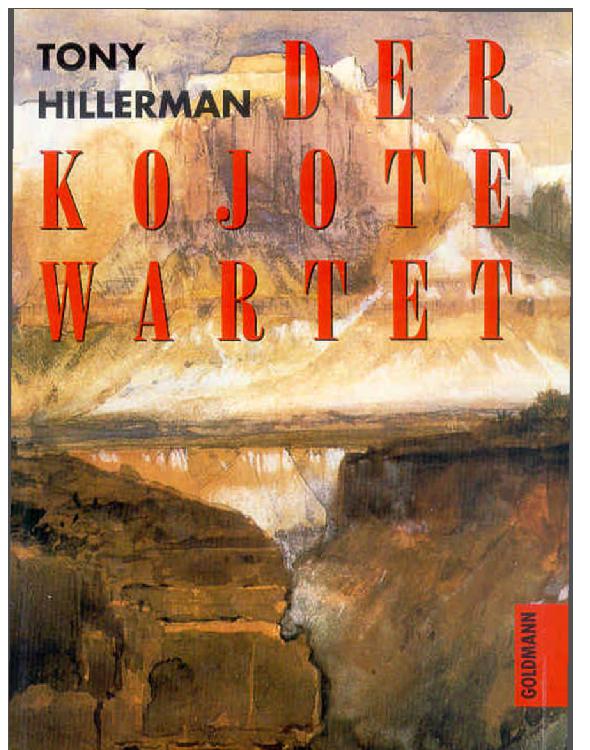![Der Kojote wartet]()
Der Kojote wartet
mit gerunzelter Stirn an, als bemühe er sich, ihn zu erkennen. Danach seufzte er, setzte sich auf die Straße, schraubte den Verschluß von sei-ner Flasche und nahm einen langen, gurgelnden Schluck Whiskey. Schließlich sah er zu Chee auf und murmelte:
»Baa yanisin, shiyaazh.«
»Du schämst dich?« wiederholte Chee. Seine Stimme versagte beinahe. »Er schämt sich!« Mit der unverletzten Hand griff er über die Schulter des Grauhaarigen und zog ihm den Revolver aus dem Hosenbund. Die Mündung roch nach verbranntem Pulver. Danach klappte er die Trommel auf. Alle sechs Kammern enthielten Patronen, aber drei davon waren verschossen. Chee steckte den Revolver in seinen Hosenbund, riß dem Grauhaarigen die Flasche aus der Hand und warf sie in hohem Bogen in die Salbeibüsche am Straßenrand.
»Dreckiger Kojote!« sagte Chee auf navajo. »Steh auf!« Seine Stimme klang scharf.
Der Mann blickte verwirrt zu ihm auf. Das grelle Scheinwerferlicht spiegelte sich in dem Regenwasser, das ihm in Bächen übers Gesicht lief und von seinen Haaren und Augenbrauen tropfte.
»Los, steh auf?« schrie Chee ihn an.
Er riß den Grauhaarigen hoch, stieß ihn vor sich her zum Streifenwagen, suchte ihn rasch nach weiteren Waffen ab und ließ ihn seine Taschen ausleeren, die ein Taschenmesser, einige Geldstücke und eine abgegriffene Geldbörse enthielten. Als er ihm Handschellen anlegte, merkte er, wie abgemagert die knochigen Handgelenke des alten Mannes waren. Wie taub seine eigene Rechte sich immer noch anfühlte, und wie der Schmerz in der linken Handfläche wühlte. Er half dem Festgenommenen auf den Rücksitz, warf die Tür hinter ihm zu und blieb noch einen Augenblick stehen, um ihn durch die Scheibe hindurch anzustarren.
»Shiyaazh«, wiederholte der Mann, »baa yanisin.« Mein Sohn, ich schäme mich.
Chee stand mit gesenktem Kopf da, während der Regen auf seine Schultern prasselte. Er fuhr sich mit dem Handrük-ken über sein nasses Gesicht und mit der Zungenspitze über die Lippen. Der Geschmack war salzig.
Dann machte er sich auf die Suche nach der Whiskeyflasche, die er in die Salbeibüsche geworfen hatte. Sie würden sie als Beweismittel brauchen.
3
Nichts war Lieutenant Joe Leaphorn unangenehmer als die Situation, in der er sich jetzt befand - daß er Leuten Hilfsbereitschaft vorspielen mußte, ob wohl er ihnen nicht helfen konnte. Diesmal ging es jedoch um Mitglieder einer Familie aus Emmas Clan, dem Bitter Water Clan, mit denen er verschwägert war. Gemäß dem weitgefaßten Verwandtschaftsbegriff der Navajos waren sie alle Emmas Brüder und Schwestern...
Daß Emma nur selten von ihnen gesprochen hatte, spielte in diesem Zusammenhang keine Rolle. Ebenfalls unwichtig war, daß Emma ihn niemals um sein Eingreifen gebeten hätte. Erst recht nicht in diesem Fall, bei dem es um den Mord an einem Polizisten ging. Aber sie hätte bestimmt versucht zu helfen, so unauffällig wie möglich-und wäre dabei ebenso machtlos wie Leaphorn gewesen. Aber Emma war tot, so daß die ganze Verantwortung nun auf ihm lastete.
»Wir wissen, daß er den Polizisten nicht erschossen hat«, hatte Mary Keeyani gesagt. »Nicht Ashie Pinto.«
Nach Verwandtschaftsbegriffen der Weißen war Mrs. Keeyani eine Nichte Ashie Pintos. Sie war eine Tochter seiner Schwester, was ihr im Turning Mountain Clan den Status einer leiblichen Tochter eingetragen hatte. Sie war eine hagere kleine Frau, die für ihren Besuch in der Stadt extra ihren altmodischen Sonntagsstaat angezogen hatte. Aber ihre langärmelige Samtbluse war viel zu weit, als stamme sie aus fetteren fahren, und ihr ganzer Schmuck bestand aus einem schmalen Silberarmband und einer Halskette mit sehr wenigen Türkisen.
Steif aufgerichtet saß sie in dem blauen Plastiksessel vor Leaphorns Schreibtisch und machte einen unbehaglichen, verlegenen Eindruck.
Während Mary Keeyani ihm nach traditioneller Navajositte ihre verwandtschaftlichen Beziehungen zu Ashie Pinto - und somit auch zu Hosteen Pintos Problem - auseinandergesetzt hatte, hatte Louisa Bourebonette überhaupt keine Erklärung abgegeben. Sie saß neben Mary Keeyani und sah Leaphorn mit entschlossener Miene an.
»Daß hier ein Irrtum vorliegt, steht völlig außer Zweifel.« Louisa Bourebonette sprach langsam, präzise und mit leichtem Südstaatenakzent. »Aber wir sind bei unseren Versuchen, mit dem FBI zu sprechen, keinen Schritt weitergekommen. Wir haben versucht, mit jemand in der Außenstelle Farmington zu reden, und sind
Weitere Kostenlose Bücher