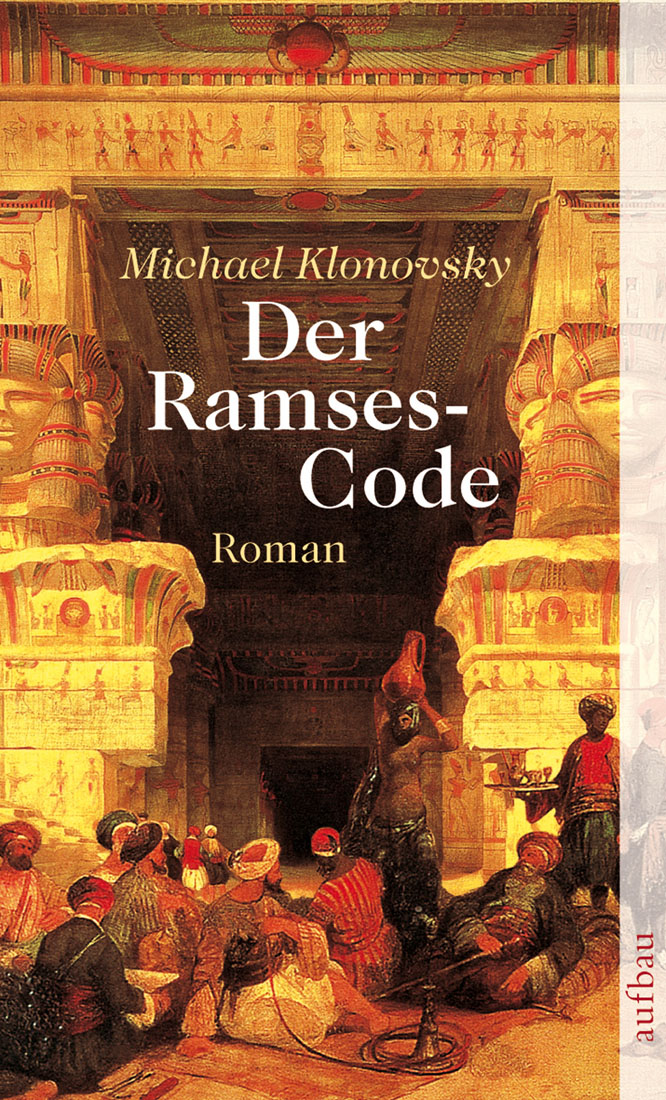![Der Ramses-Code]()
Der Ramses-Code
Altgriechisch verfaßt, während die beiden anderen aus ägyptischen Schriftzeichen bestehen. Das heißt, wir besitzen erstmals einen hieroglyphischen Text mit paralleler griechischer Übersetzung. Das ist eine wissenschaftliche Sensation!«
»Man kann die Hieroglyphen übersetzen? Sind das denn Buchstaben? Ich denke, es sind heilige Symbole.«
»Aber irgend etwas müssen sie doch symbolisieren! Unddas liegt uns jetzt auf griechisch vor. Es muß nur zurückübersetzt werden. Dann kann man die Hieroglyphen wieder lesen. Das erste Mal seit fast zweitausend Jahren!«
Der Achtjährige warf skeptisch die Lippen auf. »Ich verstehe nichts davon, aber etwas sagt mir, daß es so einfach nicht sein wird.«
Auch später im Kaminzimmer, als Jacques Champollion mit seinen Söhnen und der zwölfjährigen Marie auf das Abendessen wartete, das die Mutter und die beiden älteren Schwestern in der Küche zubereiteten, hatten die Brüder nur ein Thema: den ominösen Stein.
»Was meinst du«, fragte Jean-François, »ob du eine Abschrift bekommen kannst? Ich bin ganz verrückt danach, diese Hieroglyphen zu sehen.«
»Papa, was sind Hieroglyphen?« fragte Marie.
»Nichts für Mädchen«, knurrte der Vater, dem das Thema Ägypten auf die Nerven ging. Seit mehr als anderthalb Jahren war es zum alles beherrschenden Gegenstand im Leben seiner Söhne aufgestiegen. Damals hatte ein entfernter Verwandter, ein Hauptmann in Bonapartes 32. Linien-Regiment, das sich gerade auf den Ägypten-Feldzug vorbereitete, Jacques-Joseph in Aussicht gestellt, er könne im Troß der Wissenschaftler an dem Abenteuer teilnehmen.
Wie ein Zauberwort war der Name des fernen, jahrhundertelang von kaum einem Europäer betretenen Nillandes in das alte Haus gedrungen und hatte beide Brüder in fieberhafte Aktivitäten gestürzt: Der eine betrieb aufwendige Reisevorbereitungen, der andere nahm mit all seiner Phantasie daran teil. Nur hatte der Hauptmann seinen Einfluß augenscheinlich gewaltig überschätzt. Jedenfalls war Ende April 1798 eine Nachricht eingetroffen, die Jacques-Joseph so bitter enttäuschte, daß er tagelang mit niemandem reden wollte. Man sei bereits nach Toulon abmarschiert, von wo aus sich die Armee einschiffen werde, meldete der Hauptmann in dürren Worten. Es würde mit dem Platz im Troß nun leider doch nichts werden. Jacques-Joseph möge sich das nicht allzusehr zu Herzen nehmen, schrieb er, immerhin sei das ganze Unternehmen ja auch nicht ungefährlich, und werwolle schon für eine Ruinenbesichtigung sein Leben aufs Spiel setzen? Jener Brief war das letzte Lebenszeichen, das die Champollions von ihrem Verwandten erhielten. Er war einer der wenigen Franzosen, die in der Schlacht bei den Pyramiden fielen, als das stolze Heer der Mamelucken, mit Säbeln und Lanzen bewaffnet, vor die Mündungen europäischer Kanonen und Gewehre ritt und dort jämmerlich verblutete.
Im Kaminzimmer pflegte die Familie stets das Abendessen einzunehmen, wenn der Vater seinen Laden geschlossen hatte und aus der Stadt heimgekommen war. Jacques Champollion saß bereits am Tisch vor einem Krug Rotwein. Es kam seit einiger Zeit immer öfter vor, daß er nach dem ersten Krug einen zweiten und gelegentlich sogar einen dritten trank. Jeanne Champollion strafte ihren Mann deswegen mit mißbilligenden Bemerkungen. Da er seine Frau liebte und keinen Streit mit ihr anzetteln wollte, verfiel er gelegentlich auf ein Ausweichmanöver: Er trank daheim, wo er beobachtet wurde, etwas weniger, entkorkte aber statt dessen die eine oder andere Flasche bereits in seinem Laden.
Und warum trank Jacques Champollion? Nun, zum einen, weil es ihm schmeckte. Aber das war nicht der eigentliche Grund für seine wachsende Neigung, die Tage im Zustand wohliger Dauerbenebelung zu verbringen. Er kam einfach mit seinem Jüngsten nicht zurecht. Nicht, daß Jean-François seinem Vater Anlaß zu Klagen bot, ihm nicht gehorchte oder Widerworte gab – da hätte sich der vierschrötige Mann schon zu helfen gewußt. Aber je älter der Junge wurde, desto mehr irritierte er seinen Vater; er schien ihm vollends aus der Art geschlagen – kurz: Er war ihm unheimlich. Und in der Tat war Jean-François ein ungewöhnliches Kind, absonderlich genug, um einen einfachen, rechtschaffenen Buchhändler allmählich aus der Fassung zu bringen.
Das begann schon bei seinem Äußeren. Der Sohn hatte die schwarzen Haare des Vaters und die dunkelbraunen Augen der Mutter. Ihm wuchs eine üppige Mähne, und da zudem
Weitere Kostenlose Bücher