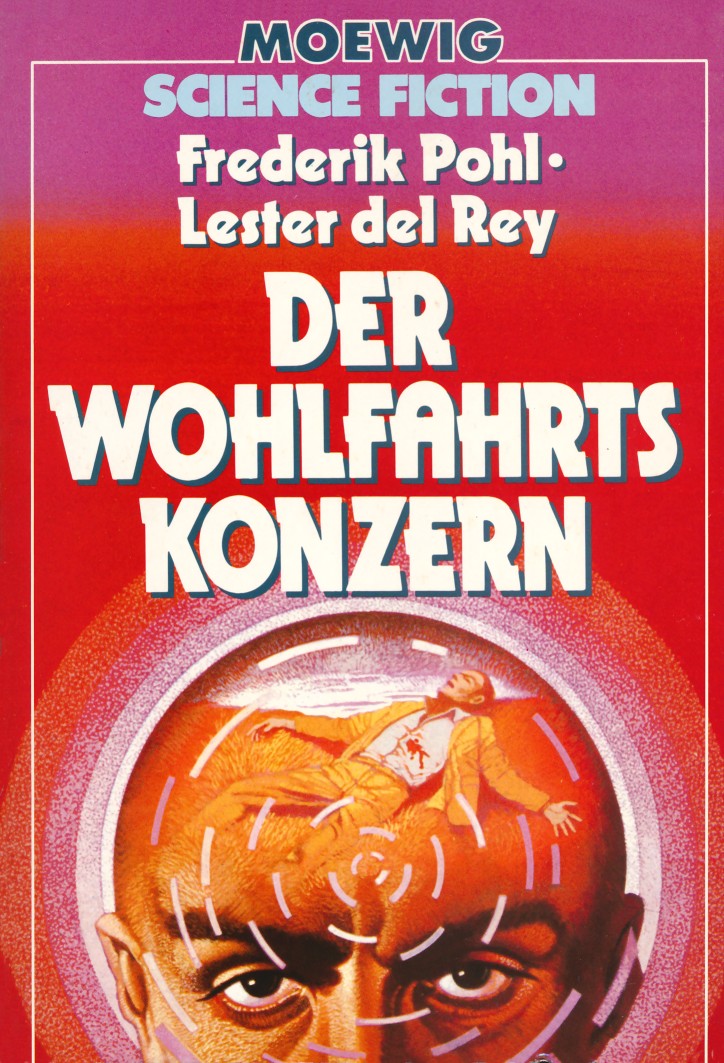![Der Wohlfahrtskonzern]()
Der Wohlfahrtskonzern
ausgeglichen und tief versunken – ein Ausdruck, den ich auch einmal auf Mariannas Gesicht gesehen hatte, als sie schlief.
Es war erstaunlich, dachte ich, wie wenig sich mein Denken noch mit Marianna beschäftigte.
Ich überlegte sehr sorgfaltig, bevor ich dem Etagenkellner klingelte, aber alles in allem schien es am vernünftigsten zu sein, sie schlafen zu lassen und abzuwarten, wie der Hoteldetektiv reagieren würde – falls es einen gab. Es gab keinen, wie sich herausstellte. Tatsächlich nahm der Kellner aber kaum Notiz von ihr, entweder aus Gleichgültigkeit oder weil er sehr genau wußte, daß ich mein Zimmer mit der offiziellen Reisekreditkarte der Gesellschaft gebucht hatte – es war aber auch nicht so wichtig. Ich bestellte etwas zu essen, wobei ich gleich abwinkte, als er die Karte präsentieren wollte und ihm sagte, er solle den Küchenchef entscheiden lassen.
Dieser traf eine vorzügliche Wahl und schickte auch eine Flasche Champagner mit herauf.
Rena kam erst langsam zu sich, um dann plötzlich mit weit aufgerissenen Augen hochzufahren. »Alles in Ordnung«, sagte ich schnell zu ihr. »Es hat Sie niemand in der Klinik gesehen.«
Sie blinzelte leicht und sagte mit weicher Stimme: »Ich danke Ihnen.« Dann seufzte sie sehr, sehr leise und erhob sich vom Bett.
Um auf Marianna zurückzukommen: Vergleiche waren immer zweifelhaft, grübelte ich, als Rena sich frisch machte, aber … Also, wenn ein fremder Mann Marianna schlafend in seinem Bett gefunden hätte, das Kleid fast bis zu den Schenkeln heraufgerutscht, so hätte er sich auf einiges gefaßt machen müssen. Auf was, das hing von den Umständen ab. Es konnte die wütende Aufforderung sein, gefälligst vorher anzuklopfen, oder es folgten einige Stunden übertrieben zimperlichen Gehabes, begleitet von häufigem Rotwerden. Aber sie würde es bestimmt nicht einfach ignorieren. Ganz anders Rena – sie zeigte gerade durch diese Haltung das genaue Gegenteil von Anstößigkeit. Letzten Endes, sagte ich mir selbst, und erwärmte mich langsam für die Idee, waren wir ja keine leicht erregbaren Jugendlichen mehr. Ich konnte das Bein eines hübschen Mädchens sehen, ohne dabei gleich völlig aus dem Häuschen zu geraten. Ich hatte sie tatsächlich kaum wahrgenommen.
Sie kam zurück und sagte freundlich: »Ich habe Hunger!« Den hatte ich auch, wie ich plötzlich feststellte. Wir aßen, ohne viel dabei zu reden. Ihr gegenüber zu sitzen gab mir einfach ein angenehmes Gefühl – trotz der Tatsache, daß sie sich gegen die Gesellschaft gestellt hatte. Ich war entspannt und fühlte mich wohl, meine Probleme waren in weite Ferne gerückt. Natürlich, so fuhr ich in meinen Gedanken fort, ich war so frei und ungezwungen mit ihr zusammen wie mit irgendeinem Mann; daß sie eine attraktive junge Frau war, hatte darauf überhaupt keinen Einfluß. Sie war für mich ganz einfach nur jemand, der ein wenig Hilfe brauchte.
Wir öffneten den Champagner nicht – es schien nicht besonders angemessen. Wir hatten während des Essens über nichts Wichtiges gesprochen, außer daß ich ihr von dem alten Mann erzählte; sie wußte augenscheinlich nichts von ihm. Sie war besorgt, aber ich versicherte ihr, daß er bei der Gesellschaft in sicheren Händen sei – womit glaubte sie denn, es zu tun zu haben? Mit Barbaren? Sie gab keine Antwort.
Nach dem Essen aber, als wir beim Kaffee waren, sagte ich: »Lassen Sie uns jetzt zur Sache kommen: Was haben Sie in der Klinik gemacht?«
»Ich habe versucht, meinen Vater zu retten.«
»Retten, Rena? Retten wovor?« fragte ich geduldig.
»Bitte, Tom! Sie glauben an die Gesellschaft, nicht wahr?«
»Natürlich!«
»Und ich nicht. Wir werden darin nie übereinstimmen. Ich bin Ihnen dankbar, daß Sie mich haben laufen lassen, und ich glaube auch, daß ich weiß, was Sie das gekostet hat. Aber das ist alles, Tom.«
»Aber die Gesellschaft …«
»Die Gesellschaft. Tom, wenn Sie von Ihrer Gesellschaft sprechen, was sehen Sie dann? Etwas Glänzendes, Wunderbares, Großartiges? Bei mir ist das ganz anders. Was ich sehe, sind die Reihen meiner Freunde, die erstarrt in den Gewölben liegen. Oder der arme alte Mann, den Sie gefangen haben.«
Man konnte mit ihr nicht vernünftig darüber reden. Sie war der festen Überzeugung, daß alle Suspendierten Opfer irgendeiner Grausamkeit waren. Das war natürlich völlig falsch. Die Suspendierung war nicht der Tod, jeder wußte das. Tatsächlich war sie die Antithese des Todes. Sie rettete
Weitere Kostenlose Bücher