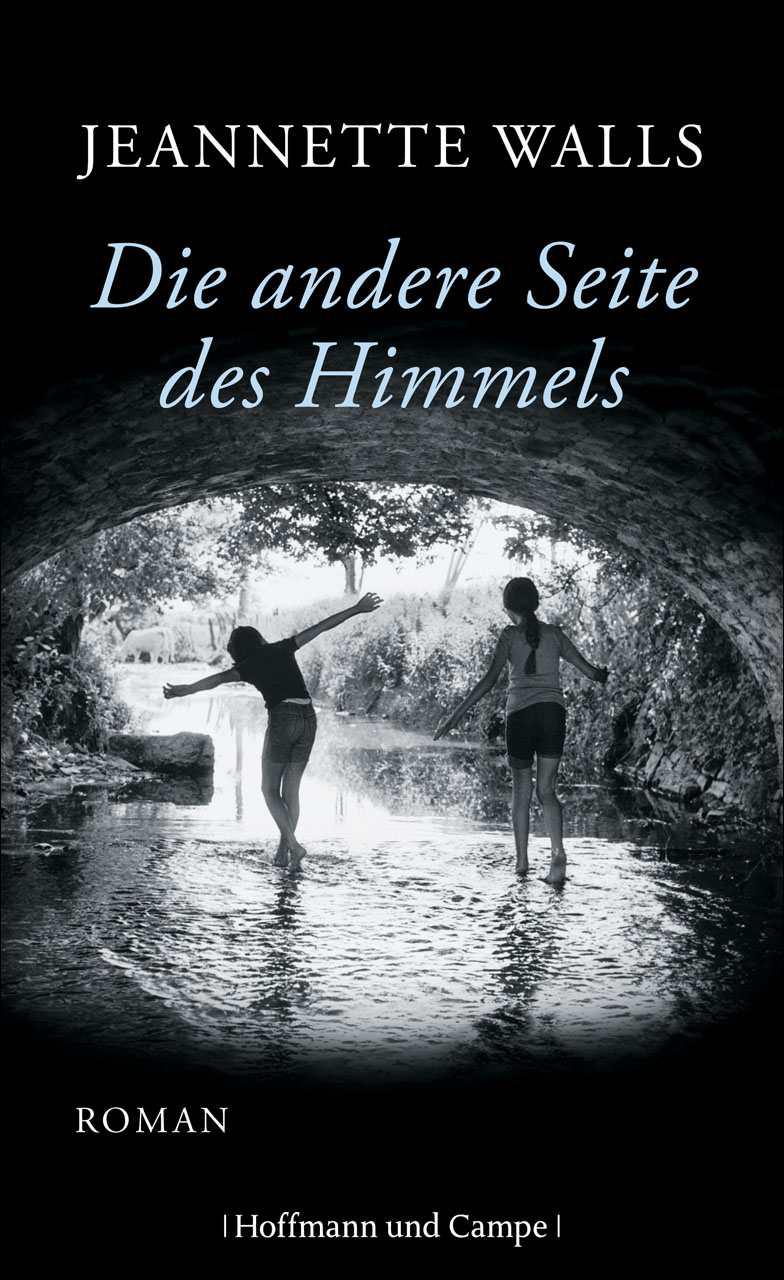![Die andere Seite des Himmels: Roman (German Edition)]()
Die andere Seite des Himmels: Roman (German Edition)
eine Reihe verglaster Türen führte.
»Ach du Schande«, sagte ich zu Liz. »Das ist das Haus, von dem ich mein Leben lang geträumt hab.«
Solange ich zurückdenken kann, hatte ich mindestens einmal im Monat so einen Traum von einem großen weißen Haus auf einer Hügelkuppe. In dem Traum öffnen Liz und ich die Eingangstür und rennen über die Flure, erkunden ein Zimmer nach dem anderen, und überall sind schöne Gemälde und teure Möbel und wehende Vorhänge. Es gibt Kamine und Verandatüren mit großen Glasscheiben, die Sonnenlicht hereinlassen, und herrliche Ausblicke auf Garten, Bäume und Hügel. Ich hatte immer gedacht, es wäre bloß ein Traum, aber das hier war genau das Haus.
Als wir näher kamen, erkannten wir, dass das Haus in einem schlechten Zustand war. Die Farbe blätterte ab, das dunkelgrüne Dach hatte braune Rostflecke, und Brombeerranken krochen an den Mauern hoch. An einer Hausecke, wo ein Stück Regenrinne abgebrochen war, sah die Verkleidung dunkel und angemodert aus. Wir stiegen die breiten Verandastufen hoch, und aus einem kaputten Fenster flog eine Amsel.
Liz schlug mit dem Messingtürklopfer gegen das Holz, wartete und klopfte erneut. Zuerst dachte ich, es wäre keiner zu Hause, doch dann sah ich durch die schmalen Glasscheiben rechts und links von der Tür eine schattenhafte Bewegung. Wir hörten das Kratzen und Schaben von Riegeln, und die Tür ging auf. Vor uns stand ein Mann, der eine Schrotflinte quer vor der Brust hielt. Er hatte zerzaustes, angegrautes Haar, seine braunen Augen waren blutunterlaufen, und er trug bloß einen Bademantel und karierte Socken.
»Verschwindet von meinem Grundstück«, sagte er.
»Onkel Tinsley?«, fragte Liz.
»Wer bist du?«
»Ich bin’s. Liz.«
Er starrte sie an.
»Deine Nichte.«
»Und ich bin Bean. Oder Jean.«
»Wir sind die Töchter von Charlotte«, sagte Liz.
»Charlottes Töchter?« Er machte große Augen. »Du lieber Himmel. Was wollt ihr denn hier?«
»Wir wollten dich besuchen«, sagte ich.
»Wo ist Charlotte?«
»Das wissen wir nicht genau«, sagte Liz. Sie holte tief Luft und fing an, ihm zu erklären, dass Mom etwas Zeit für sich gebraucht hatte und wir allein gut klargekommen waren, bis die Polizei neugierig wurde. »Da haben wir beschlossen, dich zu besuchen.«
»Ihr habt beschlossen, den weiten Weg von Kalifornien hierherzukommen, um mich zu besuchen?«
»Genau«, sagte Liz.
»Und ich soll euch jetzt einfach so aufnehmen?«
»Es ist ein Besuch«, sagte ich.
»Ihr könnt hier doch nicht so aus heiterem Himmel aufkreuzen.« Er sei nicht auf Gäste eingestellt, fuhr er fort. Die Haushälterin sei länger nicht da gewesen. Er stecke mitten in mehreren wichtigen Projekten und habe Papiere und Forschungsmaterialien, die nicht durcheinandergeraten dürften, im ganzen Haus verteilt. »Ich kann euch nicht einfach so reinlassen«, sagte er.
»Ein bisschen Durcheinander stört uns nicht«, sagte ich. »An Durcheinander sind wir gewöhnt.« Ich versuchte, an Onkel Tinsley vorbei ins Haus zu spähen, aber er füllte den Türrahmen aus.
»Wo ist Tante Martha?«, fragte Liz.
Onkel Tinsley überging die Frage. »Das ist kein Durcheinander«, sagte er zu mir. »Das ist alles penibel geordnet und darf nicht angerührt werden.«
»Und was sollen wir jetzt machen?«, fragte Liz.
Onkel Tinsley betrachtete uns lange, dann lehnte er seine Flinte gegen die Wand. »Ihr könnt in der Scheune schlafen.«
Onkel Tinsley führte uns einen Ziegelsteinweg hinunter, der unter hohen Bäumen mit blättriger weißer Rinde verlief. Inzwischen dämmerte es. Glühwürmchen schwebten wie winzige Lichtpunkte im hohen Gras auf.
»Charlotte brauchte also ein bisschen Zeit für sich und ist einfach abgehauen?«, fragte Onkel Tinsley.
»Mehr oder weniger«, sagte Liz.
»Sie kommt wieder«, sagte ich. »Sie hat uns einen Brief geschrieben.«
»Das ist wieder mal ein typisches Charlotte-Debakel.« Onkel Tinsley schüttelte angewidert den Kopf. »Charlotte«, murmelte er. »Meine Schwester hat immer nur Ärger gemacht«, erklärte er. »Als sie klein war, wurde sie verwöhnt, ein verhätscheltes Prinzesschen, und als sie dann erwachsen war, dachte sie, sie müsste alles bekommen, was sie wollte. Und damit nicht genug: Man konnte noch so viel für sie tun, es reichte nie. Gab man ihr Geld, dachte sie, sie hätte mehr verdient. Verschaffte man ihr einen Job, meinte sie, die Arbeit wäre unter ihrer Würde. Und dann, als ihr Leben schwierig wurde,
Weitere Kostenlose Bücher