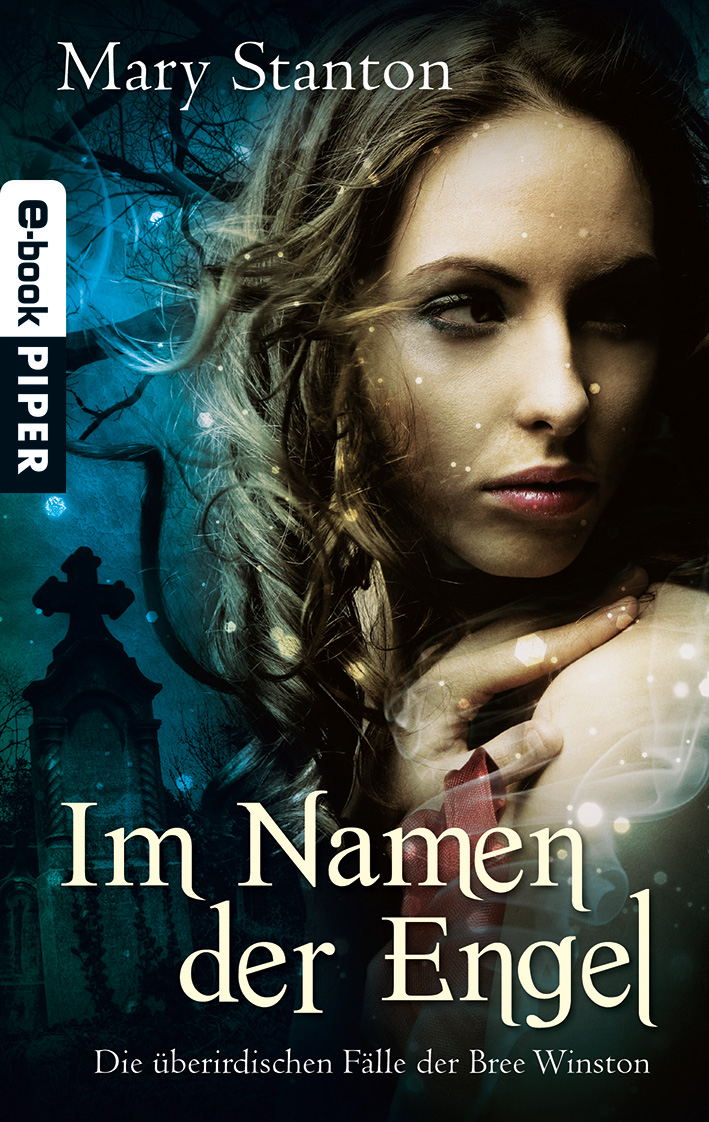![Im Namen der Engel]()
Im Namen der Engel
»Nicht dass ich mit dem Gedanken gespielt hätte abzulehnen … ich meine, ehrlich, Bree, die beste Anwaltskanzlei im Südosten …«
»Jedenfalls die einträglichste«, entgegnete sie trocken. Stubblefield, Marwick waren auf Sammelklagen spezialisiert. Spätabends im Fernsehen wurden regelmäßig Infomercials von ihnen ausgestrahlt, in denen um Raucher geworben wurde, die an Lungenkrebs erkrankt waren, um Leute mit hirngeschädigten Kindern oder um Menschen mit Asbestose.
»Unsere Liste von Klienten ist ziemlich eindrucksvoll«, stellte er lässig fest. »Ja, wir haben uns dadurch einen Namen gemacht, dass wir uns für die Rechte der Unterdrückten und Benachteiligten einsetzen …«
»Für vierzig Prozent der Summe, die bei einem Vergleich gezahlt wird«, fiel ihm Bree ins Wort. »Also wirklich, Payton.« Sie verkniff es sich weiterzureden, da sie ihm andernfalls eine Standpauke gehalten hätte, und sagte bloß: »Sie haben dir also ein Angebot gemacht, das du nicht ablehnen konntest.«
»Über dreihunderttausend im Jahr«, sagte er.
Antonia gab einen Laut von sich, der sich anhörte, als sei eine Gabel in ein Zerkleinerungsgerät geraten. »Du bist wirklich ein entsetzlicher Blödmann, Payton.«
»Ich hoffe, es macht dich glücklich«, sagte Bree höflich. »Um deinen Kontostand wirst du dir jedenfalls keine Sorgen machen müssen.«
» … und auf unserer Klientenliste stehen, wie ich ge rade erzählen wollte, einige der führenden Leute Savannahs.«
Bree runzelte die Stirn. Das zielte doch auf irgendetwas ab.
»Darunter«, fuhr Payton fort, »Dr. und Mrs. Grainger Skinner.«
»Und wer ist das?«, fragte Bree. Dann fiel der Groschen. »Benjamin Skinners Sohn und dessen Frau.«
»Sein Sohn?«, meinte Antonia. »Ach ja! Der Typ, der ans Telefon gegangen ist, als du Mr. Skinner zurückgerufen hast.«
Payton zuckte abfällig die Achseln. »Grainger Skinner selbst ist gar nicht so ein großes Tier – in Savannah zählt nämlich nicht, wie viel Geld man hat. Aber seine Frau ist eine Pendergast, und das zählt durchaus.«
Antonia achtete nicht auf das, was er sagte. »Mensch, was dir da passiert ist, war vielleicht merkwürdig, Bree. Ich meine, ich wusste gar nicht, dass Handyanrufe wie E-Mails gespeichert werden.« Vorübergehend vergaß sie, dass sie Payton die Ratte hasste, und erklärte ihm: »Wegen einer technischen Störung im Handymast hat Bree einen Anruf von Skinner bekommen, nachdem er gestorben war. Ist das nicht bizarr?«
»Quatsch ist das«, erwiderte Payton. »Bree, du weißt, dass man so oder so um Klienten werben kann. Diesmal bist du, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen zu weit gegangen.«
»Darfst du nicht«, entgegnete Bree, die merkte, dass sich das leicht schmerzliche Bedauern, das sie empfand, rasch in das dringende Bedürfnis verwandelte, gewalttätig zu werden. Sie hatte schon seit Jahren niemandem mehr ein Bier über den Kopf gegossen. Vielleicht war es ja jetzt an der Zeit, es mal wieder zu tun.
»Ich bin froh, dass ich dich hier getroffen habe. Dann brauche ich nicht extra in die …« Er hielt inne, griff in seine Anzugjacke und holte sein BlackBerry heraus. Nachdem er es konsultiert hatte, meinte er: »Angelus Street, sagtest du? Die kann ich gar nicht finden.«
»Sehr abgelegene Gegend, die aber ganz kurz davorsteht, angesagt zu sein«, sagte die loyale Antonia.
»Wohl kaum, wenn die Klienten nicht mal wissen, wo zum Teufel sie eigentlich liegt.«
Antonia sah ihn finster an. »Bree wird in kürzester Zeit zur gefragtesten Rechtsanwältin der Stadt werden.«
»Freut mich«, erwiderte Payton glattzüngig, »denn ich würde ganz gewiss nicht wollen, dass dem Ansturm neuer Klienten irgendetwas im Wege steht.«
»Was – zum Beispiel?«, fragte Bree.
»Zum Beispiel eine absolut nutzlose Ermittlung zum Tode von Benjamin Skinner.« Er beugte sich vor, faltete die Hände auf dem Tisch und legte die Stirn in ernste, besorgte Falten. »Das ist eine Sache, bei der du mir vertrauen kannst, Bree. Jeder weiß doch, dass Liz Overshaw spinnt. Die typische hysterische Frau in den Wechseljahren, wenn ich mal so sagen darf.«
»Darfst du nicht«, entgegnete Bree wiederum höflich und lächelte.
Antonia bemerkte das Lächeln und sagte nervös: »Äh, Bree …?«
Paytons Tonfall wurde noch vertraulicher als zuvor. »Ich meine, was hast du denn davon, wenn deine Karriere in dieser Stadt damit beginnt, dass du dir einen der prominentesten Mitbürger zum Feind
Weitere Kostenlose Bücher