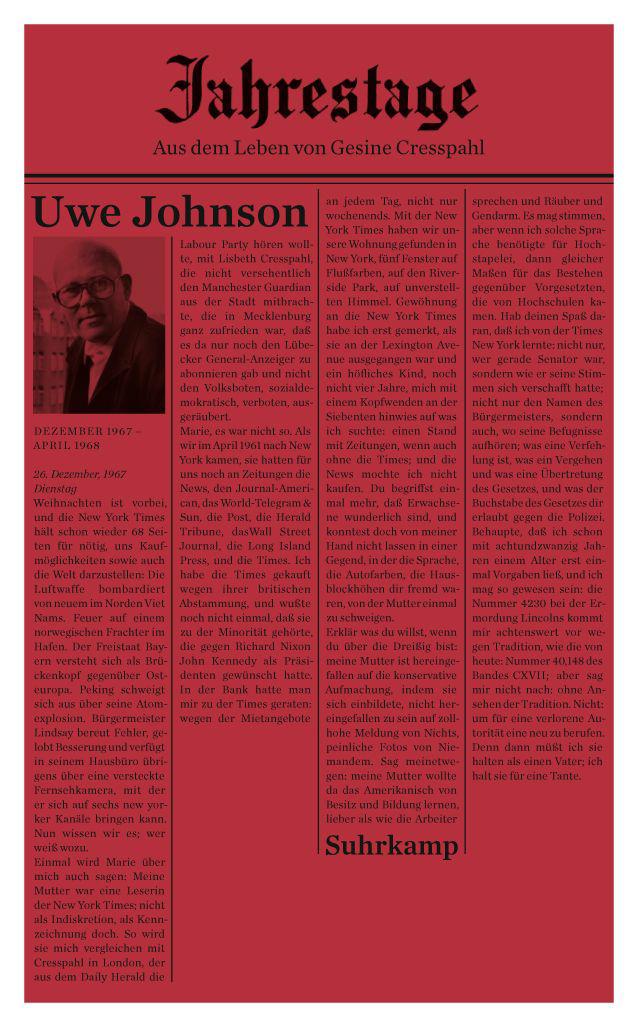![Jahrestage 2]()
Jahrestage 2
dankbaren Blick zum Lohn bekam. In Jerichow kam Gerede auf, daß er uns’ Lisbeth das Kind wegnehmen wollte, und Lisbeth bat ihn schon nach drei Tagen, das Kind bei ihr zu lassen, versprach ihm »was du willst, Heinrich«; aber Cresspahl machte es Spaß, das Kind nun den ganzen Tag in seiner Nähe zu haben, und vor allem, mit dem Kind zu reden, ihm seine Arbeit zu erklären. Nachdem er die Schrankschlösser tatsächlich angebracht hatte, wußte Hermann Liedtke eine Katzengeschichte mehr, und hatte keinen Verdacht auf das Kind, das nun geduldig den halben Tag unter dem Vordach der Werkstatt wartete, bis die Maschinen abgestellt waren oder Cresspahl einmal nach draußen kam. Cresspahl behielt das Kind bei sich, obwohl er Lisbeths Versicherungen längst glaubte; später gab er sich Rachsucht zu und wünschte, er hätte auch dies Mal nachgegeben.
Dank di ook, Dochte.
Da hab ich nicht zu Dank verdient.
Doch. Weil du es deiner Marie nicht erzählt hast. Es ist fast, als könntest du es mir nun vergessen.
Ich vergeß es dir. Ick vegæt di dat. Ick vegæt di dat!
9. Februar, 1968 Freitag
– Aus! Ende! Schluß! sagt Mrs. O’Brady, die sich hinter ihre Theke gebückt hat und nur weiß, daß schon wieder ein Kunde da ist, aber nicht welcher.
– Die Streichhölzer sind alle?
– Nein! Ach du, Gesine. Die gottverfluchten Bilder! sagt Mrs. O’Brady, die jetzt zuviel Blut in ihrem derben energischen Kopf hat und auch darüber noch erbittert ist.
– Nein. Nie Filter.
– Hier! Hier hast du, was ein Unheil sein kann für deine Gesundheit! So stell ich mir ein Buschfeuer vor! Aus der Hand haben sie mir die Hefte gerissen!
– Mir kannst du es ja sagen, Mrs. O’Brady.
– Das Nachrichtenmagazin Time, Gesine! Wo die Bilder drin sind! Es gibt Leute, die geilen sich daran auf!
– Hast du die Zeit, Mrs. Williams, Amanda?
– Hier haben Sie Time, Dschi-sain! Unerhört ist es! stellt Amanda fest, so aufgeregt, daß sie die aufgeschlagene Zeitung mehr auf den Tisch schmettert als legt. Auch sie ist etwas rot im Gesicht, spricht in höherem Ton, auch schneller als sonst. Es sind aber nicht unsittliche Bilder sondern Farbfotografien über zwei Seiten, die nach dem Überfall des Viet Cong auf die amerikanische Botschaft in Saigon gemacht wurden. Dick Swanson, Angestellter von Life, hat den Augenblick erwischt, in dem der Botschafter Bunker vor seinem Bunker, mit Soldaten und Gefolgschaft, die toten Feinde besieht, ein würdiges Weißhaupt, die Hand in der Hosentasche. Auf seinem Rasen liegen zwei Einheimische, einer fast entspannt auf dem Rücken, der andere verdreht, mit durchblutetem Hemd, Blut auch im ganzen Gesicht, nicht so rot wie das Band am rechten Arm. Auf der Einfassung der ungeheuren Blumenschüssel hinter ihm ist weiterhin Blut ausgelaufen, ein satter Fleck, an den Rändern spritzig. Es ist ein gewöhnliches Kriegsbild, aber Amanda kann sich nicht beruhigen. - Es ist gegen jede Art von gutem Geschmack! sagt sie.
– Das ist es, Amanda.
– Nicht wahr! Jedes an seinem Platz, da drüben der Krieg, und hier die Heimat! Wenn ich das beim Frühstück gesehen hätte, es wär mir aus dem Gesicht gefallen!
– Sollten wir nicht wissen, wie der Krieg ist, Amanda? Nicht nur schwarz-weiß?
– Das sagst du mir, du, Dschi-sain. Ich kenn Sie nun über Jahre, Mrs. Cresspahl, und nie hab ich Sie bei etwas Taktlosem erwischt! Sie sind so aus auf Zurückhaltung und Schicklichkeit, das ist ja geradezu britisch! Und Sie sagen mir das!
– Nicht so laut, Amanda. Die anderen denken am Ende, wir streiten uns.
– Das tun wir ja gerade! Stell dir nur mal vor, eine Frau mit einem Sohn in Viet Nam sieht das! Mrs. Agnolo sieht das! Die ist fast umgefallen! Und du bist auch noch dafür! Dschi-sain!
– Das ist genau kalkuliert! sagt David Guarani, Dokumentenprüfer, der Elegant seiner Abteilung, nicht viel über 25 Jahre, so sicher seines banktechnischen Wissens und der unausweichlichen Beförderung bewußt, daß er nicht einmal erschrak, als de Rosny durch seinen Saal ging und namenlos verblüfft erkannte, daß der Angestellte Guarani bequem auf anderthalb Stühlen gelagert war und in seiner Zeitung las, während vor ihm ein Mann auf den Knien lag, ihm die Halbstiefel salbend. Aber auch Guarani will nicht erörtern, daß die Banken Barclay und Lloyds in London sich zusammenschließen wollen, vielleicht des Plakatkriegs in der Untergrundbahn müde, was doch ein Thema für den Fachmann wäre. Martins Bank ist auch
Weitere Kostenlose Bücher