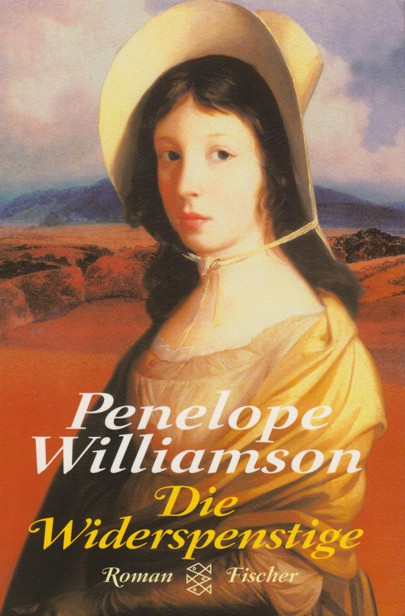![Penelope Williamson]()
Penelope Williamson
Farmen eilten zu Fuß, auf
Pferden und auf Wagen nach Merrymeeting. Sie trugen die Dinge mit sich, die sie
bei einer langen Belagerung brauchen würden.
Tyl trieb die Ochsen an. Sie waren nicht
gerade leichtfüßig, und der Weg war schlammig und hatte tiefe Karrenspuren.
Aber der Schlitten glitt leicht darüber hinweg, und bald kam die Gemeindewiese
von Merrymeeting in Sicht, dann das Haus mit dem Fahnenmast davor, das Bethaus
mit dem Pfarrhaus und die Palisaden.
Das Tor des Forts war für die Flüchtlinge weit
geöffnet worden, und auf dem Wehrgang hatten bereits Männer Posten bezogen,
deren Gewehre auf den umliegenden Wald gerichtet waren. Der Platz hinter den
Palisaden glich einem zerstörten Ameisenhaufen, denn die Leute liefen scheinbar
ziellos in alle Richtungen.
Die Tür des Blockhauses wurde aufgerissen, als Tyl durch das Tor
fuhr, und Delia kam heraus. Sie blieb in der offenen Tür stehen, und ihr erster
Blick galt Nats lebloser Gestalt auf dem Schlitten. Erst dann sah sie Tyl an.
Er hörte Megs Stimme aus dem Blockhaus. Sie schrie immer wieder: »Laß mich los!«
Er kam Delia auf halbem Weg entgegen. Er sehnte sich danach, sie
in die Arme zu nehmen. Aus Furcht, sie könnte ihn falsch verstehen, versuchte
er nur, sie mit Blicken zu trösten.
»Er ist auf dem Weg hierher gestorben, Delia. Ich habe alles versucht,
aber es war von Anfang an aussichtslos.«
Sie strich ihm mit der flachen Hand über die
Wange.
»Danke, Tyl«, sagte sie leise. Dann ging sie
zu Nat.
Sie setzte sich neben ihm auf den Schlitten,
griff nach seiner Hand und führte sie an die Lippen. Sie weinte. Tyl drehte ihr
den Rücken zu, aber nicht aus Eifersucht, sondern weil er sie verstand.
Die Sonne ging unter, und es wurde kalt. An den Fenstern der Schuppen
hinter den Palisaden blühten zarte Eisblumen. Der Mond ging rund und weiß auf
wie ein Schneeball. Er überflutete den Wald mit einem hellen, silbernen Licht.
Kurz vor Sonnenuntergang war ein Kundschafter
zurückgekommen. Er hatte die Abenaki-Krieger gesehen – es waren über zweihundert.
Sie überfielen einsame Farmen und die Hütten von Trappern, doch es gab keinen
Zweifel, daß sie nach Merrymeeting unterwegs waren.
Tyler Savitch, Oberst Bishop und Sam Randolf standen um die
Kanone. Das lange schwarze Rohr wies drohend nach Osten – in die Richtung, aus
der man die Abenaki erwartete.
Oberst Bishop, dessen Gesicht im Fackellicht dunkelrot wirkte,
starrte auf die Kanone und seufzte schwer. »Sind Sie sicher, daß das Ding
losgehen wird, Sam?«
»Zum Teufel, nein.« Sam trat so fest gegen eine eiserne Radspeiche,
daß ihm beinahe der Hut vom Kopf fiel. »Was weiß ich, das verdammte Ding ist
vielleicht nicht mehr wert als ein Kinderspielzeug. Aber ich hoffe schon, daß
sie losgeht.«
Der Oberst starrte über die Spitzen der Palisaden in die dunkle
leere Nacht. Er zog mit den Fingern an seinen dicken Lippen. »Wir haben nur
genug Munition für zwei Salven. Je nachdem, wie viele es sind, können wir
vielleicht nicht genug von ihnen umlegen.«
»So viele müssen wir gar nicht töten«, sagte
Tyl. Er umfaßte zwei der Palisadenstämme mit den Händen; die Sehnen an seinen
Handgelenken traten hervor und straften seinen lockeren Ton Lügen. »Die
Drohung der Kanone sollte eigentlich genügen.« Er versuchte, den beiden die
Einstellung der Abenaki zum Krieg zu erklären. »Sie halten nicht viel davon,
glorreich auf dem Schlachtfeld zu sterben. Ihr Ziel ist es, so viele Feinde
wie möglich zu töten und dabei selbst zu überleben, um am nächsten Tag
weiterkämpfen zu können. Für sie sagt es nichts über ihren Mut aus, wenn sie
fliehen. Wenn sie also den Eindruck gewinnen, es sei zu gefährlich, uns zu
töten, werden sie wieder in der Wildnis verschwinden und an einem anderen Ort
zuschlagen.«
Oberst Bishop legte Tyl schwer die Hand auf die Schulter. »Ich
bete zu Gott, daß Sie recht haben, Doc. Wann, glauben Sie, werden sie kommen?«
»Irgendwann heute nacht. Sehr wahrscheinlich kurz vor dem
Morgengrauen.«
Tyl ging den Wehrgang entlang. Er trug seine
geladene, schießbereite Büchse in der Armbeuge. Er würde sie benutzen, wenn
der Zeitpunkt kam, denn er wollte nicht sterben, und er wollte auch nicht, daß
Delia starb. Aber er wußte auch, jedesmal, wenn er abdrückte,
und jedesmal, wenn er einen Abenaki stürzen sah, würde es so sein, als hätte er
auch Assacumbuit, seinen Vater, töten können.
Er fühlte sich innerlich zerrissener als je
zuvor im Leben. Es war
Weitere Kostenlose Bücher