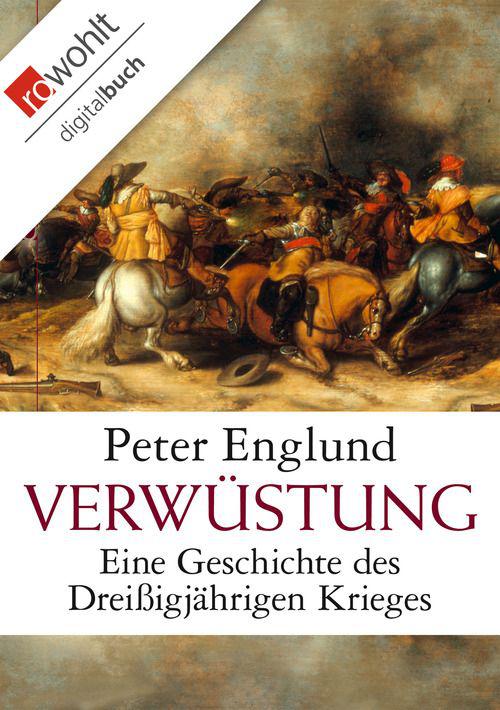![Verwüstung: Eine Geschichte des Dreißigjährigen Krieges (German Edition)]()
Verwüstung: Eine Geschichte des Dreißigjährigen Krieges (German Edition)
sich auf eine Bank und schlief auf der Stelle ein.
Nach gut einer Stunde erwachte er davon, dass ein ihm unbekannter Mensch sich am Tisch niederließ. Es war ein Fischer aus Elbing auf dem Nachhauseweg in der Dunkelheit, der eingekehrt war, um einen Krug Bier zu trinken. Er war selbst durstig nach seinem kleinen Schlummer und bestellte daher auch einen Krug Bier für sich, und nach Gesellschaft dürstend, begann er, sich mit dem Fischer zu unterhalten, der Jacob Rosencrantz hieß und ihm «sehr brav» erschien. Als der Fischer ausgetrunken hatte, legte er ein paar Münzen auf den Tisch und erhob sich, um zu gehen, doch der Mann hielt Jacob zurück und fragte ihn, «ob er nicht noch einen Krug trinken wolle». Der Fischer erwiderte bedauernd, er könne sich nicht mehr leisten. Der Fremde bat ihn daraufhin, sich zu setzen und auf seine Kosten noch ein Bier zu trinken, und später spendierte er ihm eine Mahlzeit. Jacob erzählte von sich selbst, «seinen kleinen Kindern und großen Armut» und von seiner Frau, die hochschwanger sei. Als sie sich schließlich trennen mussten, schenkte er dem Fischer einen Reichstaler, den dieser dankbar und mit «vielen tausend Segnungen» entgegennahm. Dieser eine Reichstaler an den Fischer rettete dem Mann wahrscheinlich das Leben.
Am folgenden Morgen, nach einer unruhigen Nacht, in der er sich «in großer Angst und Pein» im Bett hin-und hergeworfen hatte, begriff der Wirt, wie es um seinen Gast stand. Den Tag über lag dieser in hohem Fieber und phantasierte ruhelos. Der Wirt war selbstverständlich besorgt, teils, dass er selbst und seine Frau und Kinder angesteckt werden könnten (die Herberge bestand wie üblich nur aus einem einzigen Raum, der zugleich als Wirtsstube und Schlafraum für die Familie des Schankwirts diente), teils weil es den Geschäften nicht besonders zuträglich war, einen phantasierenden Pestkranken im Schankraum liegen zu haben. Am nächsten Tag hatte der Wirt genug. Der kranke Gast hatte allem Anschein nach nicht mehr lange zu leben, denn er war in einen tiefen Fieberdämmer versunken und nicht mehr ansprechbar. Also ließ der Wirt ihn hinaustragen zu einer Weide am Meeresufer. Dort ließen sie ihn unter dem Oktoberhimmel liegen, auf einem einfachen Lager aus Stroh und in einen Mantel gehüllt.
Und dort wäre er langsam aus diesem Leben geglitten und verschwunden, einsam und ohne Bewusstsein.
Doch als der Mann zwei Tage draußen unter dem Baum gelegen hatte, kam Jacob Rosencrantz wieder zu dem Wirtshaus, um sich wie gewöhnlich nach seinem Fischfang einen Krug Bier zu genehmigen. Der Fischer sah ihn dort am Ufer liegen, und der Wirt bestätigte ohne Umschweife, dass es sein pestkranker Gast sei. Dies machte den Fischer rasend. Er überhäufte den Schankwirt mit Vorwürfen und Drohungen: «Wenn der König von Schweden erführe, daß er seine Leute so behandle, ließe er ihn gewiß aufhängen und den Krug in Brand stecken»; er fand, «es sei nicht christlich gehandelt, einen Menschen hinauszuwerfen an einen solchen Ort, wo man nicht sicher war, daß Wölfe und andere Untiere ihn nicht fräßen, und mehr noch die katholischen und aufrührerischen Bauern ihm das Genick brächen, wie sie es täglich mit manchem ehrlichen Menschen taten». Jacob beschloss, sich selbst des hilflosen Mannes unter der Weide anzunehmen.
Die Frage war nur, was der Fischer tun sollte. Er konnte den Kranken nicht weiter in der Gefahr im Freien liegen lassen. Er konnte ihn auch nicht ins nahegelegene Elbing bringen, denn die Soldaten, die alle Eingänge der Stadt bewachten, hatten strenge Order, keinen Infizierten hereinzulassen. Deshalb trug der Fischer den Mann zu seinem Boot, wo er dem Kranken ein Lager aus Stroh und Segeltuch bereitete. Dann fuhr er ein Stück weit aufs Wasser hinaus und verankerte das Boot in einem großen Schilfdickicht. Dann verschwand er in einem kleinen ausgehöhlten Eichenstamm zurück an Land.
Der Mann blieb 21 Tage im Schilf liegen.
Eine eigentliche Behandlung erhielt er nicht. Nicht dass es eine besonders zuverlässige Behandlung gegeben hätte. Zeitgenössische Ärzte empfahlen, man solle versuchen, das Gift auszuschwitzen: Es gab eine Reihe verschiedener schweißtreibender Absude, unter anderem einen, der auf einer ziemlich harmlosen Mischung von gebranntem Salz, Essig und Eigelb basierte. Sein Pfleger machte offenbar keine größeren Anstalten mit derartigen unwirksamen Wunderkuren, sondern pflegte ihn, so gut er konnte. Jeden zweiten Tag kam der
Weitere Kostenlose Bücher