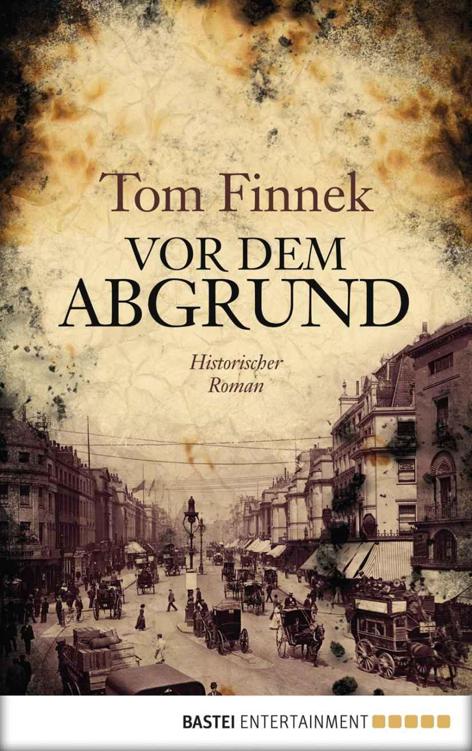![Vor dem Abgrund: Historischer Roman (German Edition)]()
Vor dem Abgrund: Historischer Roman (German Edition)
für ein schreiender Unterschied bestand zwischen dieser hingeworfenen Skizze und dem Ölgemälde, das ich vor etwa drei Jahren im Haus eines Bekannten in Mayfair bewundert hatte und durch das ich zum ersten Mal mit dem Namen Simeon Solomon in Kontakt gekommen war. Mein Bekannter, ein eitler Wichtigtuer und Banause, der sich für einen Kunstkenner zu halten schien und den ich aus dem Club kannte, hatte mir das Gemälde mit großer Geste präsentiert und im Kennerton verraten, es handele sich um einen echten Solomon und er hätte es für ein geradezu lächerliches Taschengeld ersteigert. Dabei hatte er die Augenbrauen gehoben, als müsste ich schon allein bei der namentlichen Nennung des Künstlers vor Neid erblassen. »Du weißt schon«, hatte er flüsternd hinzugesetzt, »Simeon Solomon.« Und dann hatte er selbstgefällig gegrinst über seinen großen Coup.
Der Name sagte mir nichts, doch das Bild beeindruckte mich umso mehr. Es zeigte einen gefallenen Engel und war im Stil der Präraffaeliten gehalten: überfrachtet, detailversessen, mythologisch überhöht und sehr brillant in den Farben. Es erinnerte mich an Freskenmalerei in alten Kirchen. Und doch unterschied es sich merklich von vergleichbaren Werken, die ich bislang gesehen und oft als gekünstelt abgetan hatte. Dieses Gemälde stellte kein Pathos zur Schau, sondern zeigte echten, unverstellten Schmerz. Die Sattheit der Farben und die fast überzeichnete Schönheit der Formen und Figuren standen in seltsamem Widerspruch zu der stillen Verzweiflung und tiefen Melancholie, die dem Werk innewohnten. Es schien mir beinahe so, als wollten Form und Inhalt nicht recht zusammenpassen. Und es kam mir gleichzeitig so vor, als wäre dieser Widerspruch bewusst so gestaltet. Als ich meinem Freund diese Eindrücke schilderte, lachte er mich aus. Damals sei Solomon ja noch nicht verzweifelt gewesen, meinte er. Das Bild sei etliche Jahre vor dem großen Skandal entstanden.
»Woran denkst du, Rupert?«, wurde ich plötzlich von einer knarzigen Stimme aus meinen Gedanken gerissen. »Hoffentlich nichts Lüsternes.«
Ich lachte, schüttelte den Kopf und deutete zur Theke. »Ich betrachte nur dein Meisterwerk dort drüben«, sagte ich und drückte die mir entgegengestreckte Hand. Als ich in Simeons faltiges und von einem wild wuchernden Vollbart gerahmtes Gesicht sah, war ich wie so häufig erstaunt, wie alt mein seltsamer Freund aussah. Simeon war noch keine fünfzig Jahre alt, doch seinem Aussehen nach hätte man ihn für einen Greis halten können. Das Haupthaar war ihm fast gänzlich ausgefallen, die Haut war knittrig wie Pergament, seine Zähne, die er bei jedem Lächeln bleckte, ragten schief, braun und unvollzählig aus seinem Kiefer, und seine große Nase war rot und runzlig. Vermutlich war Simeon nie ein besonders schöner Mann gewesen, doch in seiner derzeitigen Verfassung wirkte er wie die Karikatur eines feisten Trinkers aus dem Punch-Magazin.
»Lädst du mich ein?«, fragte Simeon und winkte dem Wirt, ohne auf eine Antwort zu warten. »Gin!«, rief er und deutete mit Daumen und Zeigefinger die üppige Portion an, die ihm vorschwebte.
Ich sah das Zittern der Finger und musste an Grays Bemerkung von dem Espenlaub denken. Ich fragte: »Du hast was für mich?«
Er nickte, wartete jedoch, bis der Wirt den Gin gebracht hatte und wieder verschwunden war, und sagte dann: »Kein Wort, verstanden?« Er kippte die Hälfte des Branntweins hinunter und fügte wohlig grunzend hinzu: »Wenn die rauskriegen, dass ich heimlich was verkaufe, muss ich das Geld rausrücken, und womöglich werfen sie mich hochkant auf die Straße.«
»Versteht sich von selbst«, antwortete ich, nickte und wunderte mich zugleich, dass Simeon stets dieselben mahnenden Worte voranschickte, obwohl er mir doch schon etliche Zeichnungen verkauft hatte und wusste, dass er sich auf mich verlassen konnte. Eigentlich hätte er jeden Penny, den er mit seiner Kunst verdiente, dem Arbeitshaus für Kost und Unterkunft übergeben müssen, doch was nützten ihm das nächtliche Bett und der tägliche Haferschleim, wenn er keinen Gin bekam, um sich in den Schlaf zu wiegen. Und Alkohol stand leider nicht auf dem Speiseplan der Anstalt.
»Hier!« Er holte eine abgegriffene Kladde unter seinem fadenscheinigen Mantel hervor und schob sie über den Tisch. »Es heißt: ›Verwundete Liebe‹. Was sagst du?«
Ich zog ein Papier von der Größe eines Viertelbogens aus der Kladde und betrachtete die Kohle- und
Weitere Kostenlose Bücher