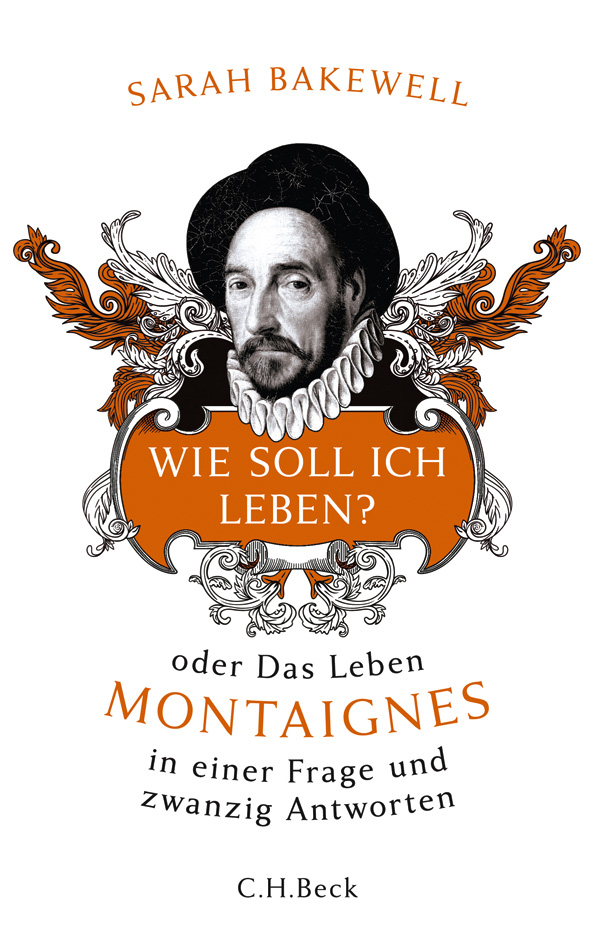![Wie soll ich leben?]()
Wie soll ich leben?
Schloss entfernt. Es war kein beschwerlicher Ausritt, weshalb er ein fügsames, aber nicht besonders kräftiges Pferd gewählt hatte. Er trug wie gewöhnlich eine Reithose, Hemd, Wams und wahrscheinlich einen Umhang. Er hatte den Degen an seiner Seite, von dem sich ein Adliger niemals trennte, aber keinen Brustpanzer oder sonst irgendeinen Schutz, obwohl außerhalb des Schlosses stets Gefahren lauerten. Straßenräuber waren nichts Ungewöhnliches, und in jener kurzen Zeitspanne zwischen zwei Bürgerkriegen befand sich Frankreich in einem recht- und gesetzlosen Zustand. Marodierende Soldaten, die in Friedenszeiten wie dieser keinen Sold erhielten, zogen beutehungrig übers Land. Trotz seiner Todesfurcht blieb Montaigne solchen Gefahren gegenüber in der Regel gelassen. Er schreckte nicht vor jedem Fremden zurück wie andere oder zuckte bei unbekannten Geräuschen im Wald zusammen. Doch vonder allgemeinen Anspannung konnte wohl auch er sich nicht ganz befreien, denn als er plötzlich von hinten ein schweres Gewicht auf sich stürzen spürte, war sein erster Gedanke, dass er angegriffen worden sei. Es war, als hätte jemand mit einer Arkebuse, dem Gewehr jener Zeit, auf ihn geschossen.
Sein Pferd wurde zu Boden gerissen, und Montaigne flog in hohem Bogen durch die Luft, schlug ein paar Meter entfernt hart auf die Erde und verlor augenblicklich das Bewusstsein.
Da lag nun mein Pferd gänzlich betäubt der Länge nach hingestreckt, ich zehn, zwölf Schritte davon entfernt, wie tot, rücklings, das Gesicht rundum voller Blutergüsse und zerschunden, mein Degen, den ich in der Hand gehalten hatte, mehr als zehn Schritte weiter weg, mein Gurt zerfetzt, und in mir kein Gefühl mehr, keine Regung: ein Holzklotz.
Den Gedanken, er habe eine Arkebusenkugel in den Kopf bekommen, hatte er erst später. In Wirklichkeit war keine Waffe im Spiel. Einer von Montaignes Leuten, ein muskulöser Kerl, der hinter ihm ritt, hatte sein kräftiges Pferd zu vollem Galopp angetrieben, um «den Wagemutigen zu spielen und sich gegenüber seinen Gefährten hervorzutun», wie Montaigne vermutete. Er bemerkte Montaigne nicht oder schätzte die Breite des Weges falsch ein und glaubte, er käme seitlich vorbei. Stattdessen stürzte er «einem Koloss gleich auf mich kleinen Reiter auf dem kleinen Pferd».
Die anderen Reiter hielten bestürzt an. Montaignes Bedienstete stiegen ab und versuchten, ihn wiederzubeleben, aber er blieb bewusstlos. Sie hoben ihn auf und versuchten, seinen erschlafften Körper ins Schloss zurückzutragen. Unterwegs kam Montaigne wieder zu sich. Sein erster Gedanke war, er sei am Kopf getroffen worden (worin ihn die Bewusstlosigkeit bestätigte). Aber er begann auch zu husten, als hätte er einen Schlag auf die Brust bekommen. Als seine Bediensteten ihn nach Luft ringen sahen, stellten sie ihn auf die Füße und schleppten ihn so nach Hause. Mehrmals erbrach er einen Klumpen Blut – ein alarmierendes Symptom, aber das Husten und das Blutspucken hielten ihn wach.
Als sie sich dem Schloss näherten, gewann er zwar mehr und mehrsein Bewusstsein wieder, fühlte sich aber immer noch eher, als würde er in den Tod hinübergleiten, statt ins Leben zurückzufinden. Er sah alles verschwommen und nahm kaum das Tageslicht wahr. Zwar hatte er durchaus ein Gefühl für seinen Körper, aber es war eher unangenehm. Seine Kleider waren mit erbrochenem Blut verschmiert. Der Gedanke an die Arkebuse tauchte kurz auf, bevor Montaigne wieder wegdämmerte.
Später berichtete man ihm, er habe sich hin- und hergeworfen und versucht, mit den Fingernägeln sein Wams aufzureißen, als wolle er sich einer Last entledigen. «Mein Magen war damals von dem geronnenen Blut übervoll, und meine Hände fuhren ganz von selbst dorthin, wie sie oft gegen das Geheiß unsres Willens an die Stelle fahren, wo es uns juckt.» Es schien, als wolle er seinen Körper in Stücke reißen oder sich seiner entledigen, damit seine Seele entweichen konnte. Dabei fühlte er sich innerlich ganz ruhig:
Mir schien mein Leben nur noch am Rande der Lippen zu hängen, und ich schloss die Augen, als wollte ich so mithelfen, es ganz zu vertreiben; ich genoss es, mich der Mattigkeit hinzugeben und mich gehnzulassen. Es war ein Empfinden, das nur leicht über die Oberfläche meiner Seele streifte, so schwach und so hauchzart wie alles Übrige – und dabei nicht nur jedes Unbehagens bar, sondern zudem von der wohligen Süße durchdrungen, die man verspürt, wenn man in den Schlaf
Weitere Kostenlose Bücher