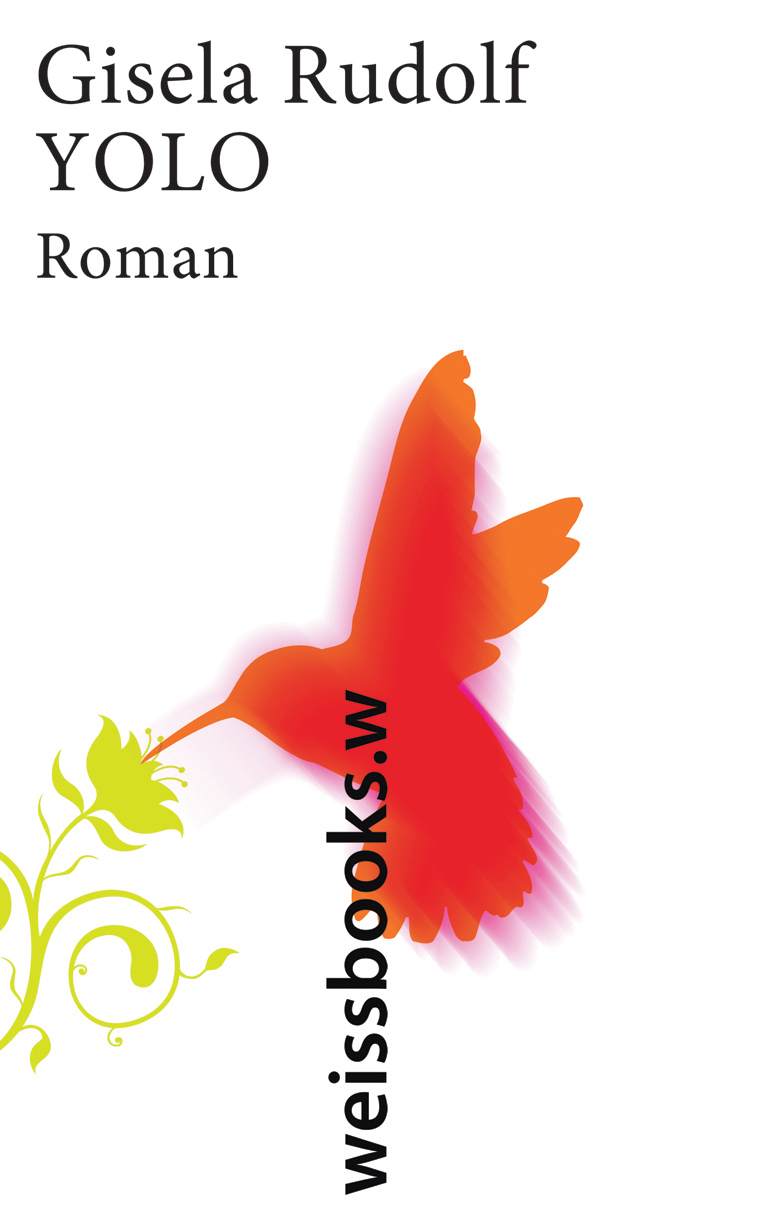![Yolo]()
Yolo
erneut nach Jutta. Mittags hatte man mir nur gesagt, dass sie nicht in der Klinik sei, und sich im Übrigen auf das Arztgeheimnis berufen. Ich insistierte, mit der Dame reden zu können, die Jutta und mich an jenem frühen Morgen verabschiedet hatte.
Obwohl schon außer Dienst erschien sie, war freundlich. Kurz angebunden zwar – um mich zu schonen, nahm ich an. Was sie mir zu berichten hatte, trieb auch ihr Tränen ins Gesicht.
»Sie wissen«, sagte sie zum Schluss, »Ihre Freundin Jutta war sehr krank, ich hoffe, das hilft Ihnen, ihren Tod zu akzeptieren.«
Ja – doch meine Wut, mehr noch: mein Hass auf den betrunkenen LKW -Fahrer, der Juttas Wagen auf einem Viadukt bei Genua gerammt hat, hat sich bis heute nicht gelegt.
Nach der Schreckensnachricht spazierte ich an den See, saß dort bis zur Dunkelheit, zog mich aus und schwamm hinaus. Als ich in die Schlingpflanzen geriet, wendete ich schaudernd. Vom Ufer her lachte Jutta mich aus, laut und rotzig – warte nur, rief ich, bis ich bei dir bin, dann umarme ich dich klatschnass!
Ich schlief in Etappen, fing mitten in der Nacht zu packen an, packte nach dem nächsten Erwachen einiges wieder aus und legte mir die Sportkleider auf einem Stuhl zurecht.
Zur Walkingstunde erschien außer mir vorerst niemand. Jean-Claude wollte mit seiner einzigen Patientin schon loslegen, da kam Gabriel Feigenblatt: »Als ich euch vom Fenster aus gesehen habe, hat mir das den Mumm gegeben, ebenfalls anzutreten.«
In gehobener Stimmung walkten wir drei los. Obwohl die zwei Männer anfänglich etwas miteinander wetteiferten, wurde das Sportliche dann eher nebensächlich. Sie begannen sich gegenseitig zu necken. Jean-Claude mit der Kraft des attraktiven Trainers, Gabriel mit dem Charme seiner Scheu – und ich konnte mich ablenken, ohne mich bemühen zu müssen. Die beiden sanken nie auf das Niveau blödelnder Erwachsener ab, alberten auch nicht wie Kinder herum. Sie genossen ganz einfach den Moment sorgloser Fröhlichkeit. Als wir uns abschließend im alten Parkteil ins Gras setzten, ich in ihrer Mitte, sagte Gabriel: »Wollen wir uns nicht lieber hinlegen und in den Himmel schauen?«
Und so lagen wir noch eine Weile beieinander, blickten den Wolken nach und schwiegen.
Ohne ein letztes Gespräch mit DeLauro hätte ich die Klinik ungern verlassen. Es ergab sich nach dem Mittagessen. Nicht ganz zufällig, ich glaube, wir wollten das beide, als wir uns am frühen Nachmittag auf der Bank beim See trafen.
»Hier sind wir schon einmal zusammen gesessen.«
»Ja.«
»Und nun bin ich quasi reisefertig.«
»Ich habe nie daran gezweifelt, dass Sie den Glauben an sich selber und alle Energie, die es für ein glückliches Leben braucht, zurückgewinnen werden.«
»Grazie, Signore, noch ist es nicht ganz so weit. Aber auf dem richtigen Weg bin ich schon, das weiß ich. Und Sie haben mir dabei wesentlich geholfen.«
»Macché, ach was.«
»Ma sì, sicher mehr als der Psychiater. Er hat mich heute übrigens belehrt,
Normalheit
gebe es nicht.«
»Da hat er wohl recht; sich selbst mit eingeschlossen.«
»Er meinte den Ausdruck an sich.«
»Normalsein, Normalheit … Verrücktheit gibt es doch auch?«
»Ach, lassen wir Moeller beiseite. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich wieder genug Selbstvertrauen habe, das Leben mit all seinen Herausforderungen anzupacken.«
»Zu den Herausforderungen des Lebens gehört vor allem die Kunst des Glücklichseins.« DeLauro formte mit seinen Händen eine Schale: »Das Glück zerrinnt nicht, solange man die Finger nicht spreizt.«
Während des Gesprächs realisierte ich beschämt, dass DeLauro von Tibors Besuch und von der Wahrheit, die meine Schuld widerlegt, noch gar nichts wusste. Nach einer etwas umständlichen Einleitung fing ich mit dem Erzählen an.
Kaum hatte ich dem Signore alles geschildert, steckte er sich eine Zigarette an. Es war bloß eine Zigarette, und ich rauchte nicht mit. Dennoch war mir, als schmauchten wir gemeinsam eine Friedenspfeife …
Mein Gepäck stand schon in der Halle, und an der Rezeption plagte ich mich noch mit Administrativkram herum, da stand DeLauro wieder neben mir: »Darf ich Sie hinausbegleiten?«
Auf dem kurzen Weg zum Taxi sagte er nur einen Satz: »Ich freue mich über Ihr neues Selbstvertrauen derart, als wenn Sie meine Tochter wären.«
Beim Einsteigen steckte er mir eine Karte zu.
Erst im Zug las ich den handgeschriebenen Text:
Doch letztlich liegt des Lebens Sinn
Allein darin es zu erhalten
Es
Weitere Kostenlose Bücher