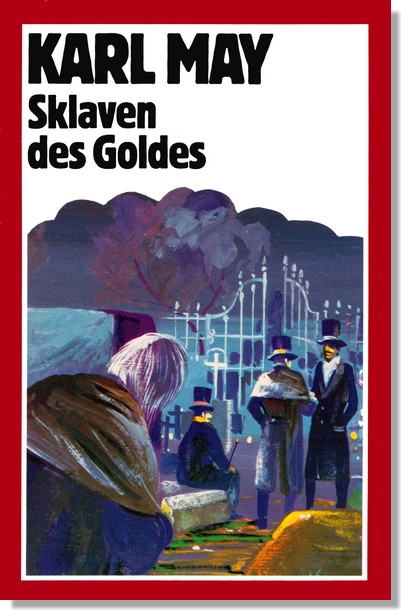![63 - Der verlorene Sohn 04 - Sklaven des Goldes]()
63 - Der verlorene Sohn 04 - Sklaven des Goldes
bin Offizier, du bist Tänzerin. Wir beide haben unsere Pflichten, unsere Zukunft; aber jeder die seinige für sich. Wir können uns nichts nützen; wir können uns nur schaden, wenn wir weiteren Umgang pflegen. Ich will avancieren, und du kannst eine gute Partie machen, wenn du mich nicht mehr kennst. Ich hoffe, daß du mit mir einverstanden bist.“
„Aber das Kind?“
„Es war, ist und bleibt das deinige; mich aber laß von jetzt an damit in Ruhe!“
„Und du meinst wirklich, daß ich darauf eingehe?“
„Ja, denn ich halte dich für klug.“
„Nun gut, so will ich einmal nicht klug sein. Ich erkläre dir hiermit, daß ich dich nicht freigebe.“
„Über diese Erklärung kann ich nur lachen.“
„Lache jetzt. Später wirst du einsehen, daß du sehr unklug gehandelt hast. Ich habe dich lieb. In Güte hättest du mir irgendein Übereinkommen ablocken können. Ich hätte Rücksicht auf deine Zukunft genommen. Auf deine kalte, rohe Weise aber wirst du gar nichts erreichen!“
„Wollen das abwarten!“
„Du kannst das Kind nicht ableugnen!“
„Das Kind nicht, aber meine Vaterschaft.“
„Du hast dich in hundert Briefen als Vater gefühlt!“
„Das beweist nicht, daß ich derselbe auch wirklich bin.“
„Wie nun, wenn ich mit diesem Kind und mit diesen Briefen einst vor deine Braut träte?“
„Ich würde dich fortzubringen wissen.“
„Deine Braut würde auf mich hören. Du triebst mich mit deiner Härte zum Widerspruch. Ich bin gegenwärtig mittellos. Selbst wenn ich engagiert werde, bedarf ich einer Summe für die erste Zeit. Ich bin bereit, dir alle meine Ansprüche zu verkaufen.“
„Ich kaufe nichts, was ich auch ohne Geld haben kann!“
„Unmensch!“
„Gib dir keine Mühe! Du änderst die Ansicht doch nicht, welche ich jetzt von dir habe. Du weiß also nun, was ich denke und was ich wünsche. Wir kennen einander nicht, und wir legen einander nichts in den Weg. Versuchst du dennoch, das letztere zu tun, so sorge ich dafür, daß man dich einen Spaziergang nach dem Zuchthaus unternehmen läßt. Leb wohl, und füge dich darein.“ –
Mit dem Morgenzug, welcher den Juden Salomon Levi nach Rollenburg gebracht hatte, war noch ein anderer aus der Residenz gekommen, nämlich – der Baron Franz von Helfenstein.
Der war seit dem Verschwinden seiner Frau sehr oft nach Rollenburg gekommen, um anzufragen, welche Erfolge die polizeilichen Recherchen und Nachuntersuchungen gehabt hatten. Die Antwort war stets dieselbe gewesen. Man hatte nicht die geringste Spur gefunden. Es gab nicht den mindesten Anhalt, dieses rätselhafte Verschwinden zu erklären.
Er hatte seine Schritte natürlich nach der Anstalt des Direktor Mars gelenkt, den er beim ersten Frühstück traf. Mars empfing ihn höflich und fragte:
„Doch wieder in Sorge um die Verschwundene?“
„Natürlich, lieber Doktor!“
„Setzen Sie sich, Herr Baron!“
„Hat man keinen Erfolg gehabt?“
„Leider noch gar keinen.“
„Welch eine Polizei!“
„Sie ist nicht allwissend.“
„Das braucht sie nicht zu sein. Sie soll nur scharf beobachten und dann gut kombinieren.“
„Wo und wie soll man beobachten, wenn man kein Objekt dazu findet?“
„Das Objekt ist eben meine Frau.“
„Sie ist ja nicht da. Nein, das Objekt der Beobachtung könnte eben nur meine Anstalt sein, und da hat sich eben nicht das kleinste Zeichen der Entführung finden lassen.“
„Hm“, machte der Baron, indem er einen eigentümlich forschenden Blick auf den Irrenarzt warf.
„Was meinen Sie?“ fragte dieser, als er diesen Blick, der ihm auffallen mußte, bemerkte.
„Ich habe einen Gedanken, der mich nicht wieder verlassen will, seit er mir gekommen ist.“
„Darf ich ihn erfahren?“
„Ich weiß doch nicht!“
„Ich meine, Herr Baron, daß wir nur dann Erfolg haben können, wenn wir Hand in Hand gehen. Und da ist vor allen Dingen die unumwundenste Aufrichtigkeit nötig.“
„Eigentlich.“
„Also, bitte, aufrichtig sein!“
„Und Sie werden mir es nicht übelnehmen?“
„Ich bin mir keiner Schuld oder auch nur Nachlässigkeit bewußt; also kann von einem Übelnehmen gar nicht die Rede sein.“
„Nun wohl! Erinnern Sie sich noch unseres Gesprächs bei meiner letzten Anwesenheit, ehe meine Frau verschwand?“
„Ja.“
„Es war da von einer Gratifikation die Rede?“
„Glaube ich.“
„Auch davon, daß der Tod besser sei als ein unheilbarer Wahnsinn. Besinnen Sie sich?“
„Sehr gut.“
„Ich gab Ihnen den
Weitere Kostenlose Bücher