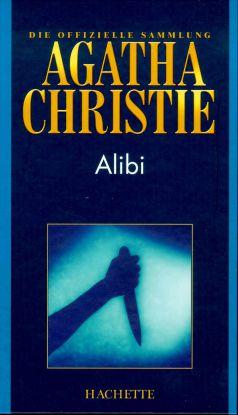![Alibi]()
Alibi
fehlenden vierzig Pfund …»
«Die dürfte Ackroyd Ralph gegeben haben», warf ich ein.
«Ja, er mag seine ablehnende Haltung revidiert haben. Aber eins bleibt immer noch ungeklärt.»
«Was?»
«Wie konnte Blunt mit solcher Sicherheit behaupten, dass Raymond um neun Uhr dreißig bei Ackroyd gew e sen sei?»
«Das hat er uns doch erklärt.»
«Finden Sie? Lassen wir das beiseite. Geben Sie mir statt dessen irgendeinen Grund an, der Patons Verschwinden erklären könnte.»
«Das ist schon etwas schwieriger», versetzte ich langsam. «Aber vielleicht lässt sich vom Standpunkt des Arztes eine Erklärung finden. Ralph muss die Nerven verloren haben. Vielleicht ist er nach einer stürmischen Unterredung mit Mr. Ackroyd noch einmal zurückgekommen, um ihn zu besänftigen, sich zu entschuldigen – was weiß ich –, und findet seinen Onkel ermordet vor. Kühle Überlegung kann man in einem solchen Augenblick nicht erwarten. Flucht ist der erste Gedanke, und so versteckt er sich. Wie oft handeln Menschen so, gebärden sich trotz ihrer Unschuld wie Schuldige!»
«Ja, das ist richtig.» Poirot nickte. «Aber einen sehr wichtigen Punkt dürfen wir nicht unbeachtet lassen.»
«Ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Das Motiv! Geld! Der Tod seines Stiefvaters bringt Ralph Paton ein großes Vermögen.»
«Ein Grund …?»
«Finden Sie noch mehr?»
«Aber ja. Drei sogar. Erkennen Sie diese denn nicht? Irgend jemand stahl den blauen Briefumschlag mit Inhalt. War es Ralph Paton? Hatte er vielleicht Mrs. Ferrars erpresst? Wie der Anwalt uns mitteilte, hat der junge Mann in letzter Zeit niemals von seinem Onkel Geld erbeten. Er muss also andere – Einkünfte gehabt haben. Jetzt aber war er wieder in Geldverlegenheit, fürchtete, dass sein Onkel davon erfuhr – der zweite Grund, und schließlich der, den Sie selbst soeben erwähnten.»
«Mein Gott», sagte ich bestürzt, «der Fall sieht sehr bös für ihn aus.»
«Finden Sie?» fragte Poirot. «Darüber sind wir beide nicht gleicher Ansicht. Drei Motive – das ist beinahe zu viel. Ich bin geneigt anzunehmen, dass Ralph Paton schließlich doch unschuldig ist.»
14
N ach dem abendlichen Gespräch, das ich soeben wiedergegeben habe, schien die Angelegenheit in ein neues Stadium zu treten. Das Ganze zerfällt deutlich in zwei grundverschiedene Teile. Der erste e r streckt sich von dem Freitagnacht erfolgten Tode Ackroyds bis zu dem darauf folgenden Montagabend. Er umfasst den Bericht der Ereignisse, wie er Poirot geboten worden war. Ich wich die ganze Zeit über nicht von se i ner Seite. Ich sah, was er sah. Ich versuchte nach Kräften seine Gedanken zu erraten. Wie ich heute weiß, war ich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Obwohl Poirot mir alle seine Entdeckungen zeigte, zum Beispiel den goldenen Ehering, behielt er die wesentlichen und doch logischen Anhaltspunkte, die er daraus gewann, für sich.
Wie gesagt, bis Montagabend könnte mein Bericht ebenso gut von Poirot stammen. Aber nach diesem Montag trennten sich unsere Wege. Poirot arbeitete auf eigene Faust. Ich erfuhr zwar, was er tat, da man in King’s Abbot alles erfährt, aber er zog mich nicht im voraus ins Vertrauen.
Und auch ich ging meinen eigenen Beschäftigungen nach.
Einige Zwischenfälle schienen zu der Zeit unwesentlich und bedeutungslos. So zum Beispiel die Frage der schwarzen Stiefel.
Doch davon später … Um aber streng in chronologischer Reihenfolge vorzugehen, muss ich mit Mrs. Ackroyd beginnen.
Sie ließ mich Dienstag am frühen Morgen holen, und da es sehr dringlich zu sein schien, erwartete ich, eine Schwerkranke zu finden.
Die Dame lag zu Bett; dies war das Zugeständnis, das sie der bestehenden Situation machte. Sie reichte mir ihre Hand und bat mich, auf einem Stuhl neben dem Bett Platz zu nehmen.
«Nun, Mrs. Ackroyd», fragte ich, «was fehlt Ihnen?»
«Ich bin erschöpft», sagte Mrs. Ackroyd mit schwacher Stimme, «vollkommen fertig. Das kommt vom Schreck über den Tod des armen Roger. Sofort spürt man das nicht. Die Reaktion kommt erst später.»
Es ist ein Jammer, dass der Arzt aus Berufsrücksichten sehr oft nicht sagen darf, was er denkt. Stattdessen schlug ich ein Beruhigungsmittel vor. Mrs. Ackroyd schien damit einverstanden. Ich glaubte nicht einen Augenblick an ihre so genannte Krankheit oder Erschöpfung.
«Und dann die gestrige Szene», fuhr meine Patientin fort. Sie hielt inne, als erwarte sie von mir ein Stichwort.
«Welche Szene?»
«Doktor, wie können
Weitere Kostenlose Bücher