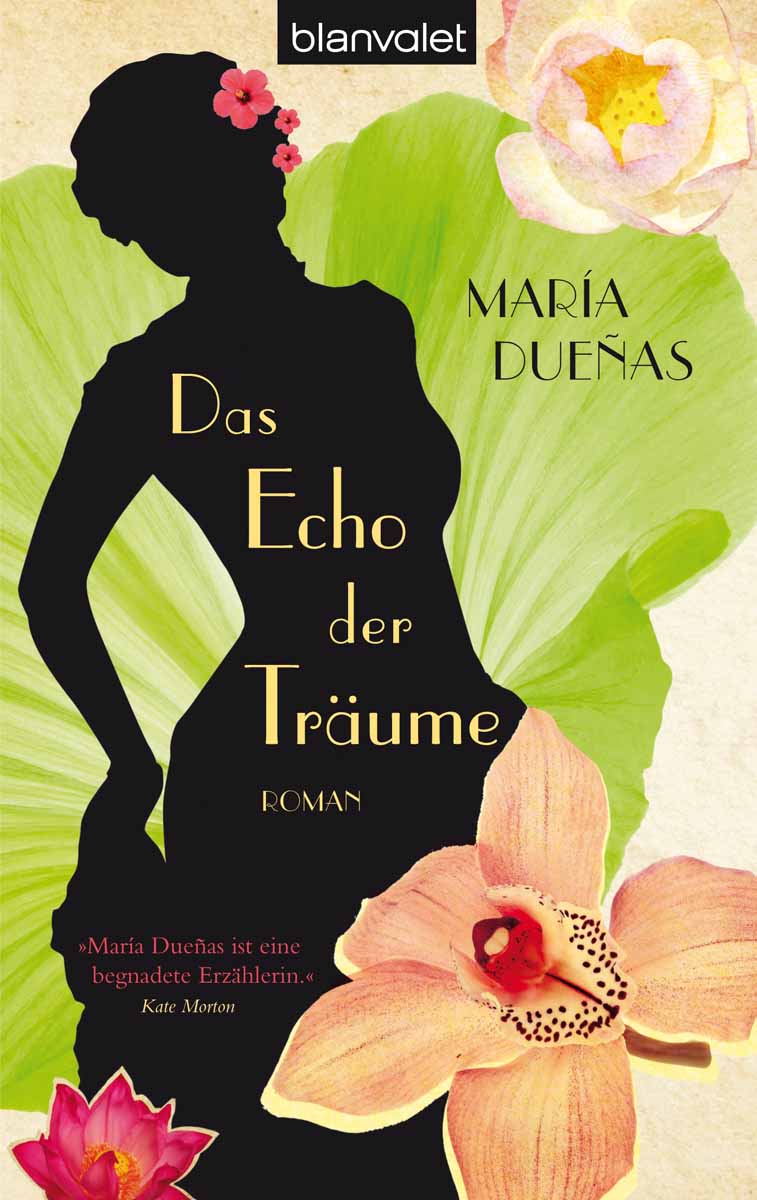![Das Echo der Traeume]()
Das Echo der Traeume
bügelte meine einzige Seidenbluse und nahm die Strümpfe von der Leine, auf der sie in der kühlen Nachtluft zum Trocknen gehangen hatten. Es waren dieselben Strümpfe wie am Tag zuvor, ich besaß keine anderen. Ich zwang mich, ruhiger zu werden, und streifte sie sorgfältig über, damit sie in der Eile keine Laufmasche bekamen. Und jede dieser mechanischen, in der Vergangenheit tausendfach wiederholten Bewegungen hatte an jenem Tag zum ersten Mal einen ganz bestimmten Adressaten, einen Zweck und ein Ziel: Ramiro Arribas. Für ihn kleidete ich mich an, für ihn parfümierte ich mich, damit er mich anschaute, damit er mich roch, damit er mich wieder berührte und sich in meine Augen versenkte. Für ihn wollte ich mein Haar, mein glänzendes langes Haar, das mir bis halb auf den Rücken reichte, offen tragen. Für ihn schnallte ich den Gürtel in der Taille so eng, dass ich kaum mehr atmen konnte. Für ihn, alles nur für ihn.
Ich ging schnellen Schrittes durch die Straßen, ohne auf die begehrlichen Blicke und groben Anzüglichkeiten zu achten. Ich zwang mich, nicht nachzudenken: Ich wollte die Tragweite meines Handelns nicht ermessen, ich wollte keinen Gedanken daran verschwenden, ob dieser Weg mich an die Pforte des Paradieses führte oder geradewegs ins Verderben. Ich ging die Costanilla de San Andrés hinunter, überquerte die Plaza de los Carros und steuerte durch die Cava Baja auf die Plaza Mayor zu. In zwanzig Minuten hatte ich die Puerta del Sol erreicht, in weniger als einer halben Stunde begegnete ich meinem Schicksal.
Ramiro erwartete mich bereits. Kaum erkannte er meine Silhouette an der Eingangstür, beendete er sein Gespräch mit einem anderen Angestellten, griff sich Hut und Trenchcoat und kam eilends auf mich zu. Als er vor mir stand, wollte ich ihm sagen, dass ich das Geld in meiner Handtasche hatte, dass Ignacio ihn grüßen ließ, dass ich vielleicht schon am Nachmittag beginnen würde, auf der Maschine zu üben. Doch er ließ mich nicht, begrüßte mich nicht einmal. Er lächelte nur, eine Zigarette im Mundwinkel, berührte mich flüchtig am unteren Ende meines Rückens und sagte: » Gehen wir.« Und ich ging mit ihm.
Der Ort, den er ausgewählt hatte, hätte nicht harmloser sein können. Er führte mich ins Café Suizo. Nachdem ich mit Erleichterung feststellte, dass ich in dieser Umgebung wohl nichts zu befürchten hatte, glaubte ich, dass es vielleicht doch noch eine Rettung für mich geben könnte. Ich dachte sogar, während er einen Tisch suchte und mich bat, Platz zu nehmen, dieses Treffen sei vielleicht nur eine besondere Aufmerksamkeit gegenüber einer Kundin. Mich beschlich sogar der Verdacht, seine dreisten Avancen könnten nichts weiter gewesen sein als eine Ausgeburt meiner überbordenden Fantasie. Aber dem war nicht so. Trotz der unverfänglichen Umgebung geriet ich bei unserer zweiten Begegnung erneut an den Rand des Abgrunds.
» Seit du gestern gegangen bist, habe ich ununterbrochen an dich gedacht«, flüsterte er mir ins Ohr, kaum dass wir uns gesetzt hatten.
Ich fühlte mich zu keiner Entgegnung fähig, die Worte gelangten gar nicht erst in meinen Mund, wie Zucker in Wasser lösten sie sich an irgendeiner Stelle im Gehirn auf. Wieder nahm er meine Hand und streichelte sie wie am Tag zuvor, ohne den Blick von ihr zu wenden.
» Sie sind ein bisschen rau hier und da. Sag, was haben diese Finger gemacht, bevor sie zu mir kamen?«
Seine Stimme klang ganz nah und sinnlich, fern die Geräusche um uns herum: das helle Klirren von Glas, der dumpfe Klang von Steingut, wenn es mit einer marmornen Tischplatte in Berührung kam, das Gemurmel der morgendlichen Unterhaltungen und die Stimmen der Kellner, die an der Theke ihre Bestellungen aufgaben.
» Nähen«, flüsterte ich, ohne ihn anzusehen.
» Du bist also Schneiderin.«
» Ich war es. Inzwischen nicht mehr.« Endlich hob ich den Blick. » In letzter Zeit gibt es nicht viel zu tun«, fügte ich hinzu.
» Deshalb willst du jetzt Maschineschreiben lernen.«
Er schlug einen freundschaftlichen, vertrauten Ton an, als würde er mich kennen, als hätten unsere Seelen seit Anbeginn der Zeit aufeinander gewartet.
» Mein Verlobter meint, ich solle mich auf die Auswahlprüfungen zum Staatsdienst vorbereiten, damit ich dort eine Stelle bekomme, so wie er«, sagte ich ein wenig verschämt.
Der Kellner brachte unsere Getränke, und es entstand eine Pause. Für mich eine Tasse heiße Schokolade, für Ramiro einen Kaffee, schwarz wie die
Weitere Kostenlose Bücher