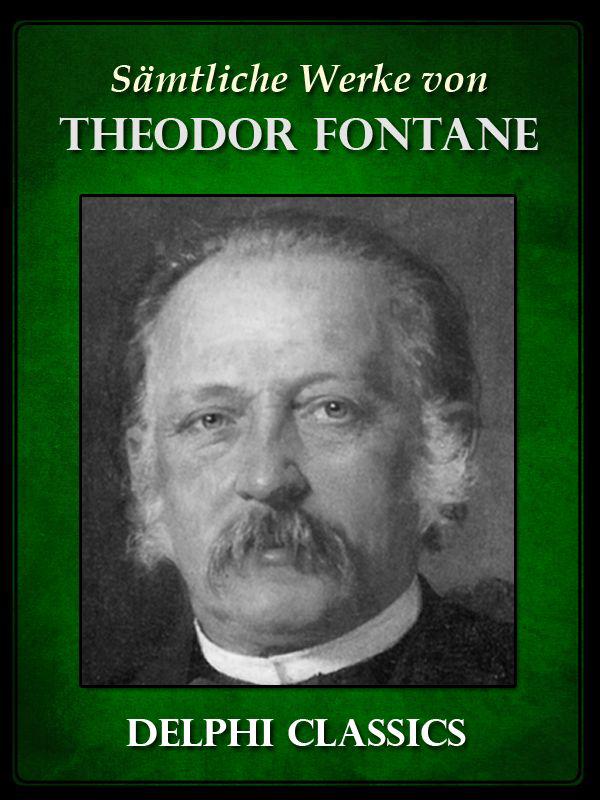![Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)]()
Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)
so wurde nun alles ungarisch eingerichtet und nicht nur Pferde, Tabak und Wein, auch Diener, Koch und Kammermädchen kamen aus Ungarn. Die Dorfleute sagten, ihr Herr sei ein Türke geworden. Alles ging ungrisch und die Wirtschaft polnisch dazu. 1837 verkaufte er das Gut und ging in die Welt. Seitdem ist er verschollen.
In der Erinnerung der Dörfler hat er nur schwache Spuren zurückgelassen, aber das Bild des alten »Neck- und Feuerteufels«, der vor ihm da war, lebt fort von Geschlecht zu Geschlecht. Auch das Volk hat künstlerische Instinkte und unterscheidet Kopie und Original. Und wenn jung und alt abends beim Biere sitzen und von alten Zeiten plaudern, verweilen sie gern bei dem kleinen Kobold, »der keine Furcht kannte«, und erzählen sich mit immer gleichem Behagen die Schnurren und Schabernackstreiche vom tollen »Geist von Beeren«.
Berlin in den Tagen der Schlacht von Großbeeren
Es war am 19. August 1813 – so entnehm ich alten, durch Friedrich Tietz veröffentlichten Aufzeichnungen –, als an den Straßenecken Berlins und zugleich in der »Vossischen« und »Spenerschen Zeitung« folgende Bekanntmachung erschien:
»Wir eilen, die treuen Untertanen Seiner Majestät des Königs hierdurch zu unterrichten, daß in der Nacht vom 10. zum 11. d. M. die Kriegserklärung Österreichs gegen Frankreich erfolgt und der Waffenstillstand ebenso kaiserlich-russischer- wie unsrerseits gekündigt worden ist. Die Zeit der Waffenruhe ist mithin überstanden, und der gerechteste Krieg, der jemals geführt worden, hat wieder begonnen.
Berlin, 18. August 1813
Allerhöchst verordnetes Militär-Gouvernement für das Land zwischen der Elbe und Oder
von L’Estocq – Sack«
Scharenweise standen die Berliner an den Ecken, um diese Bekanntmachung zu lesen. Enthusiastisch und mit Hurra wurde sie begrüßt, aber es muß doch auch zugestanden werden, daß es nicht an Vorsichtigen, um nicht zu sagen an Ängstlichen, fehlte. So wurden beispielsweise viele Frauen und Kinder, die man nach Pommern und Mecklenburg hin in Sicherheit bringen wollte, von den zurückbleibenden Hausvätern zum Frankfurter und Oranienburger Tor hinausbegleitet.
Andre waren geschäftig, ihre silbernen Löffel im Garten einzugraben oder ein paar alte, noch von irgendeinem Paten herstammende Schaumünzen unter der Zimmerdiele zu verstecken.
Unterdessen hatten wir seltsame Hilfe gegen den Feind erhalten. Wallensteins eben damals oft von Mattausch auf der Königlichen Bühne gehörte Worte: »Wir werden mit den Schweden uns verbinden, gar wackre Leute sind’s und gute Freunde«, hatten sich als Prophezeiung erwiesen. In der Nähe von Charlottenburg standen die blonden Nordlandssöhne im Lager, zu denen alle Welt hinausging und ihnen bundesfreundlich die Hand schüttelte. Nur zu ihrem Führer, dem neuen Kronprinzen von Schweden, wollte bei den Berlinern ein rechtes Vertrauen nicht Wurzel fassen, weil man sich seiner noch zu gut als Bernadotte erinnerte, der früher kein Preußenfreund gewesen war. Außer den Schweden waren auch die Russen bei der Hand, von denen wir aber meistens nur das langspießige Volk der Kosaken zu sehen bekamen.
Am 21. August gab man im Königlichen Schauspielhause Kapellmeister Himmels »Fanchon«. Das Haus war voll, wie man sich denn überhaupt an allen öffentlichen Orten zusammendrängte, bloß um Neuigkeiten zu hören. Der korpulente Kapellmeister stand dirigierend an seinem Pult, und als Gern (der Vater) in der Rolle des Abbé das Lied »Auf alle Namenstag im Jahr« anzustimmen begann und zuletzt auch zu dem auf die verewigte Königin Luise bezüglichen Couplet kam, erscholl ein donnernder Jubel im ganzen Hause. Himmels rotes Angesicht glühte vor Erregung. »Tusch, Tusch!« rief er dem Orchester zu, die Trompeten schmetterten, und die Vivats wollten kein Ende nehmen.
Als ich das Theater verließ, begegnete ich draußen einer ähnlichen Exaltation: Truppen marschierten dem Halleschen Tore zu, von Bürgern unter fortwährendem Hurrarufe begleitet.
Am folgenden Tage wurd uns das unmittelbare Bevorstehn einer Schlacht so gut wie zur Gewißheit: die Truppenmärsche steigerten sich, und im schwedischen Lager sah man die Vorbereitungen zum Aufbruch. Am Abend war ich, wie herkömmlich, wieder im Theater, aber ich konnte nicht recht in Stimmung kommen und noch weniger lachen, trotzdem Wurm, unser erster Komiker damals, den Rochus Pumpernickel spielte. Iffland hatte klüglich immer nur lustige Stücke aufs Repertoire
Weitere Kostenlose Bücher