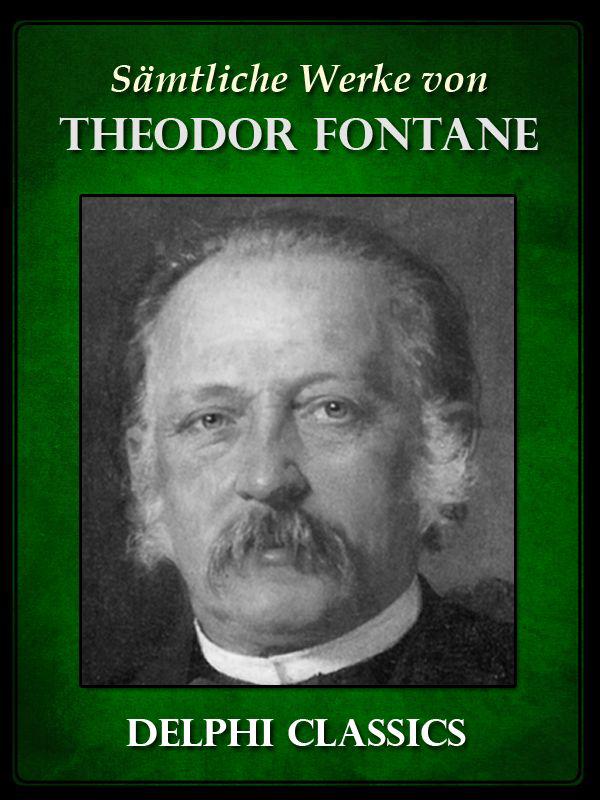![Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)]()
Delphi Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illustrierte) (German Edition)
wenige Jahre später war, mit Hilfe derselben, der ursprüngliche 30 000-Taler-Fonds auf 100 000 Taler angewachsen, was, bei dem natürlichen Hange der Menschen, sich ihrer eingegangenen Verpflichtungen nicht zu erinnern, einen Maßstab dafür abgeben mag, welche Höhe der Stiftungsfonds eigentlich hätte gewinnen müssen. Der alte Hertefeld half nämlich immer »auf Wort« und nahm es nie genau mit der Ausstellung von Schuldscheinen.
In den letzten Jahren seines Lebens schritt er zur Gründung eines Familien-Fideikommisses, auf dessen nähere Festsetzungen ich an anderer Stelle zurückkomme.
Den 17. Februar 1867 starb er. Aus dem Templinschen und Ruppinschen und nicht zum wenigsten aus der Hauptstadt selbst waren am Begräbnistage viele Hunderte zur Erweisung der letzten Ehre herbeigekommen, an ihrer Spitze die Kriegervereine von Zehdenick und Oranienburg, und hatten, vom Schloß bis zur Kirche hin, Spalier gebildet. An der Spitze des Zuges schritten sieben Geistliche, von denen der Zehdenicksche die Trauerrede hielt. Er gedachte des Verstorbenen als eines treuen Patrioten, eines Vaters seiner Untergebenen, eines immer bereiten Helfers der Armen, Witwen und Waisen. Und dabei hob er unter großer Bewegung aller derer, die die Gruft umstanden, hervor, daß er, als er dem nun in Gott Ruhenden in seiner letzten Lebensstunde noch eine Witwe zur Unterstützung empfohlen habe, nicht nur der altgewohnten Herzensgüte, sondern auch noch dem schönen und christlichen Worte begegnet sei: »Machen wir’s gleich, Pastor; ich habe nicht viel Zeit mehr zu verlieren.« Und so sei sein letztes irdisches Tun jenes Wohltun gewesen, das überhaupt sein Leben ausgemacht habe.
So der Geistliche.
Danach aber trugen sie den zinnernen Sarg, dem man oben, nach Sitte des vorigen Jahrhunderts, eine Glasplatte gegeben, in die Gruft und setzten ihn an die Seite seiner ihm im Tode voraufgegangenen Gattin.
Und damit war der letzte Sproß des alten clevischen Geschlechts der Hertefelds zu seinen Vätern versammelt!
5. Kapitel
Liebenberg unter den Eulenburgs von 1867 bis jetzt
Am 27. Februar 1867 war Karl von Hertefeld gestorben, und in Gemäßheit einer vorher festgesetzten Erb- oder Sukzessionsordnung folgten im Besitze von Liebenberg die Eulenburgs . In dieser Sukzessionsordnung aber hieß es: »Das von mir unterm 3. November 1866 gestiftete Fideikommiß fällt zunächst an meine Großnichte Alexandrine Freiin von Rothkirch, seit 1848 vermählt mit dem Grafen Philipp zu Eulenburg , zur Zeit (1866) Major im 3. Ulanenregiment zu Potsdam. Danach aber an den ältesten Sohn dieser Ehe, den Grafen Philipp zu Eulenburg den jüngeren, geboren 1847, zur Zeit Lieutenant im Regiment Garde du Corps. Da mein Geschlecht und Name mit meinem Ableben erlischt, so stell ich anheim, ob die Besitzer dieses von mir gestifteten Fideikommisses ihrem eigenen Namen den Namen Hertefeld beifügen wollen oder nicht.«
Friedrich Leopold von Hertefeld
Alexandrine v. H., geb. 1774;
verm. m. Graf Danckelmann
1792
Karl v. H., geb. 1794
(Letzter Hertefeld)
|
Luise , Comtesse Danckelmann,
geb. 1801;
verm. b. Baron Rothkirch 1821
|
Elise v. R., geb. 1822;
Clara v. R., geb. 1828;
Alexandrine v. R., geb. 1824.
Antoinette v. R., geb. 1830.
Diese vier Baronessen Rothkirch waren also Enkelinnen von Alexandrine von Hertefeld (geboren 1774) und Großnichten von Karl von H., des »letzten Hertefeld«. An sie kam das Erbe, und zwar an die zweite Schwester Alexandrine, vermählt mit Philipp Graf Eulenburg . Auch die drei andern Schwestern vermählten sich: Elise mit dem österreichischen Baron Diller, Adjutanten des Feldmarschalls Heß, Clara mit dem Baron von Esebeck, Major im Garde-Füsilierregiment, und Antoinette mit dem Grafen von Montault zu Paris. Alle drei sind jetzt verwitwet.
Es war hiernach Liebenberg, als Frauenerbe, an die bis dahin ausschließlich in Ostpreußen begüterte Familie der Eulenburgs übergegangen.
Die Eulenburgs , ein uraltes meißnisches Geschlecht das sich nach der jetzigen Stadt Eilenburg an der Mulde (zwei Meilen von Leipzig) die »Ileburgs« nannte, leitet seinen Ursprung von den Wettiner Burggrafen ab. Otto von Ileburg, gestorben 1234, Herr und Vogt der Herrschaft Eilenburg, auch im Saalkreise begütert, war, nach alter, inzwischen historisch bestätigter Tradition des Hauses, ein Enkel des Burggrafen Ulrich von Wettin. Etwa 150 Jahre nach dem Tode jenes Otto von I. hatte das Geschlecht
Weitere Kostenlose Bücher