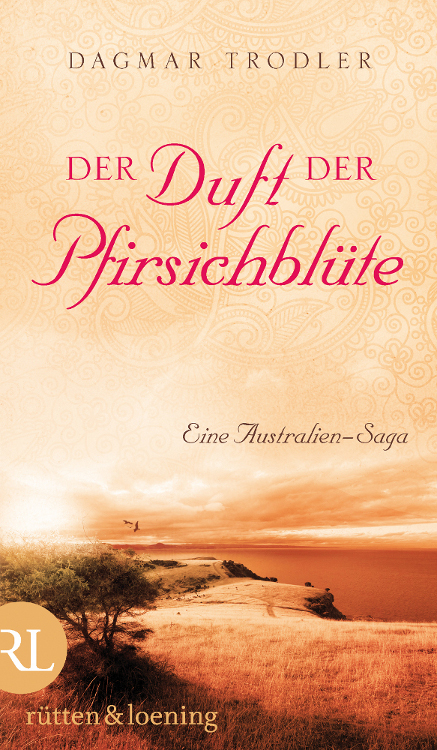![Der Duft der Pfirsichblüte - eine Australien-Saga]()
Der Duft der Pfirsichblüte - eine Australien-Saga
hätte das lieber selbst getan, noch niemals zuvor hatte sie sich bedienen lassen. Doch fehlte ihr die Kraft dafür. Niemand sprach ein Wort. Penelope war das Entsetzen über den ausgemergelten Leib ihrer Mutter anzusehen. Ausgetrocknet und schrundig war er geworden und gelb wie Senf.
Dass ihr Herz nur noch schwach schlug, musste der Doktor ihr nicht sagen, als er spät in der Nacht heimkehrte. Das spürte sie selber. Er nickte ihr nur ernst zu und nahm sie dann behutsam auf seine Arme, um sie auf das Bett zu legen, das er wohl mit Penelope teilte. Heute Nacht würde es ein Krankenlager sein, und sein Gesichtsausdruck verriet, dass es nicht für lange sein würde. Auch Mary wusste das. Sie hatte Penelope gerade noch zur rechten Zeit gefunden.
»… nein, Trunksucht vermutlich nicht … eine Infektion, die Leber … ist sehr krank …«, wehten Gesprächsfetzen an Marys Ohr. »… ob wir ihr noch helfen können …«
Sie war nicht allein, das spürte sie. Es kostete Kraft, den Blick durch das Zimmer wandern zu lassen. Ihre Tochter saß an ihrem Bett und wartete einfach, es gab ja nichts mehr zu tun. Mary schloss die Augen, dankbar für die Ruhe, die Penelope ausstrahlte. Sie schien sanft auf sie und schenkte ihr Erleichterung. Penelope hatte ihr Glück gefunden. Es gab nichts mehr zu tun.
In den frühen Morgenstunden wurde Mary unruhig. Schwarze Schatten glitten durch ihren Geist, winkten sie zu sich. Sie hatte nicht mehr viel Zeit. Und Mary begann, in die Dunkelheit hinein zu sprechen, erst langsam, dannimmer hastiger, weil die Schatten sich näherten. Irgendwer würde ihr wohl zuhören.
»Ach, Penny, so viele Menschen sind ertrunken. Verfluchtes Schiff. Ich bin in eines der Boote gezogen worden. Ich saß dort mit drei anderen, als das Boot kenterte, nach der Explosion. Bin an Land gespült worden, jemand hat mich aus dem Wasser gezogen und mit in die Fabrik genommen. Dort hab ich gearbeitet. Tagelang. Wochenlang. Monatelang. Es gab frisches Brot an Weihnachten.«
»Mutter …«, flüsterte Penelope und strich ihr vorsichtig über die heiße Stirn.
»Lass mich reden, mir bleibt nicht mehr viel Zeit, und du sollst doch alles wissen.« Mary rang nach Luft. Sie trank einen Schluck Wasser und beruhigte sich wieder etwas. »Dann konnte ich im Gefängnis bleiben. Als Aufseherin. Sie fanden es gut, dass ich nicht viel redete. Was soll ich auch sagen? Verdammt, was soll ich noch sagen?« Mary schwieg für einen Moment. »Ich hab immer versucht, dich zu finden. Das war so schwer, wenn man sich nicht bewegen kann. Schwer war das …«
Penelope begann zu weinen und nahm sie in die Arme. Mary verstand, dass es für Penelope genauso unmöglich gewesen war, sie zu suchen. Sanft strich sie über den weichen Arm.
»Ich habe versucht, ihn zu finden, Mutter.«
Mary wusste sofort, wen sie meinte. »Dein Vater ist tot. Er starb.«
»Warum hast du es mir nicht gesagt? Warum hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Warum hast du all die Jahre geschwiegen?«
Ja, warum? Es war Egoismus gewesen, der sie hatte schweigen und den geliebten Mann für sich behalten lassen.Aber das konnte sie nicht sagen. Mary fühlte Scham in sich hochsteigen. »Ich … ich wollte nicht, dass du … dein Vater war ein Sträfling. Ein zum Tode Verurteilter. Das war nichts, worauf man stolz sein konnte.« Sie sah Penelope an, dass die Erklärung nicht ausreichte. Bevor ihre Tochter weiterfragen konnte, lenkte Mary das Gespräch in eine andere Richtung. »Hat er dich also gefunden und geheiratet, der Doktor. Er ist der beste Mann, Penny, der beste, den du haben kannst. Ich … wir haben ihn geholt, dass er dich aus der dunklen Zelle rausholen soll. Er ist sofort gekommen und jetzt … Du hast jetzt ein neues Leben.«
»Ach, Mutter …« Penelope weinte still.
Mary sah sie nur an, dann strich sie ihr leise über die Wange. Etwas anderes brannte ihr auf der Seele, viel dringender als alles andere. Es verzehrte sie Tag und Nacht, war schlimmer als alle Sünden, die sie je begangen hatte. Sie wollte Vergebung, nur ein Wort von ihrer Tochter … »Dein Kind, Mädchen. Ich habe versucht, es zu retten. Ich bin geschwommen und habe es dabei fast verloren, die Decke war so schwer, und das aufgewühlte Wasser wollte sie mir aus den Armen ziehen. Ich hatte dich aus den Augen verloren – ich wollte nicht noch sie verlieren. Aber mir gingen die Kräfte aus, gegen das Wasser anzukämpfen, gegen die verfluchten Wellen rings um das Schiff, und immer wieder Hände,
Weitere Kostenlose Bücher