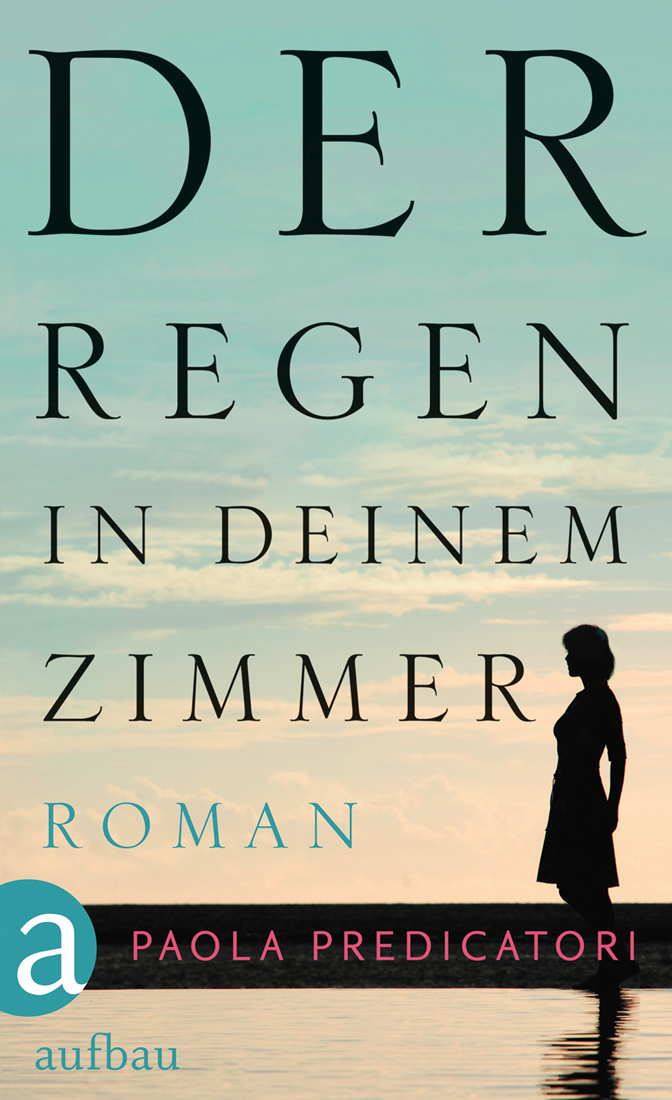![Der Regen in deinem Zimmer - Roman]()
Der Regen in deinem Zimmer - Roman
zu entgehen und zu begreifen, was eigentlich gerade geschah. Meine Mutter nahm mich ebenfalls beiseite, und ich hoffte inständig, dass man mir meine Angst nicht ansah. Sie setzte alles daran, gefasst zu wirken, doch die Schatten unter ihren Augen und ihre angespannte Miene sprachen für sich. Sie sagte genau das, was ich schon von Nonna wusste, aber als ich das Wort Krebs aus ihrem Mund hörte, schossen mir die Tränen in dieAugen. Sie nahm mich fest in die Arme und sagte, es gebe Therapien und mit mir zusammen würde sie es schaffen. In dem Moment wurde aus mir wir und ihr Krebs wurde zu meinem. In jenen Tagen barst mein Kopf vor Fragen: Die Symptome? Hatte sie wirklich nichts bemerkt? Wann hatte alles angefangen? Warum hatte sich niemand über ihren plötzlichen Gewichtsverlust gewundert? Wieso bemerkte sie immer alles, wenn es um mich ging, aber ich, die ich sie doch liebte, hatte mir keine Gedanken um sie gemacht? Wenn man jemanden liebt, sollte man sich doch um ihn kümmern! Und wenn meine Liebe derart verantwortungslos war, hatte ich sie dann vielleicht nicht genug geliebt?
Meine Mutter und ich hatten nie viel geredet, und daran änderte sich auch während ihrer Krankheit nichts, aber wir fingen an, uns mit Blicken zu suchen, einander die Hand zu drücken, wenn wir zusammen einen Film anschauten, und uns still zuzulächeln, ein inniges Lächeln, angefüllt mit einer Hoffnung, die uns niemand gegeben hatte. Meine Großmutter war stets zur Seite und unterstützte meine Mutter in allen Entscheidungen, bis hin zur letzten. Während der ganzen zwei Jahre habe ich meine Großmutter nie weinen sehen. Manchmal erschien sie mir wie ein anderer Mensch, angefüllt mit einer Kraft, die aus früherem Schweigen in fernen, jungen Jahren rührte und nun wieder zum Tragen kam.
Wenige Tage vor der OP konnte ich nicht mehr an mich halten und erzählte es meinen Schulfreundinnen. Als es so weit war, bekam ich einen Haufen SMS und Mails, auch von Leuten, von denen ich seit einer Ewigkeit nichts gehört hatte. Ich hatte niemandem gesagt, dass es kein heilender Eingriff seinwürde, und all diese vor Leben und Zuversicht strotzenden Nachrichten hatten zur Folge, dass ich mich jedes Mal beherrschen musste, das Handy nicht an die Wand zu pfeffern. Als ich ein paar Tage später wieder in die Schule kam, war der Sensationseffekt bereits abgeflaut. Alle erkundigten sich, wie die OP gelaufen sei, wie es meiner Mutter gehe, und das war’s. Als ich einige Zeit darauf abermals fehlte, fragte niemand mehr nach. Meine Freundinnen hörten auf, mich zu besuchen, und ich besuchte sie nicht mehr. Mit der Ausrede, in solchen Situationen lasse man einen Menschen besser in Ruhe, wurde es leer um mich. Die beiden folgenden Jahre verbrachte ich wie unter einem Schatten. Klausuren, Prüfungen, Samstagabende in der Disco, Schwimmbad, Stadtbummel, aber in allem, was ich tat, war meine sterbende Mutter. Ihr Tod war überall: im Rucksack zwischen den Schulbüchern, in den rosig klaren Frühlingsabenden, aber vor allem in ihrem mutlosen, wissenden Blick. Ich weiß noch, dass ich jeden Tag wünschte, sie würde es entgegen allen Prognosen schaffen: Wir hätten noch Zeit und hätten gelernt, sie nicht zu vergeuden und das, was wir uns zu sagen hatten, nicht aufzuschieben.
Wenn jemand mich fragte, was ich von diesen zwei Jahren erinnere, würde ich antworten, nichts Besonderes: die Gesten, das Lächeln, die kleinen Alltäglichkeiten. Das ist das Leben, das habe ich jetzt begriffen. Nicht die Dinge zählen, sondern die Augenblicke. Ich glaube, selbst meine Art zu atmen hat sich verändert: Ich habe gelernt, die Luft anzuhalten, als hätte ich die ganze Zeit unter Wasser verbracht und nur darauf gewartet, wieder nach oben zu kommen. Und ständig war da die Angst.Ich kann mich an einen Film erinnern, in dem eine Frau kurz vorm Sterben ihre Töchter zu sich ruft und jeder einzelnen eine Art Abschiedsrede hält. Meine Mutter tat nichts dergleichen. Das Einzige, was sie bis zum Ende nicht müde wurde mir zu sagen, war, dass sie mich liebte und dass ich das Schönste sei, was ihr im Leben widerfahren sei. Wenn wir zusammen waren, musste ich ihr viel erzählen, von der Schule, von meinen Freundinnen, davon, was ich einmal machen wollte. Und dann, gegen Ende, als sie schon sehr schwach war, bat sie mich einfach, mich zu ihr aufs Bett zu setzen. Dann streckte ich mich neben ihr aus und nahm ihre Hand oder sie legte mir ihre aufs Haar und wir schlummerten ein, als
Weitere Kostenlose Bücher