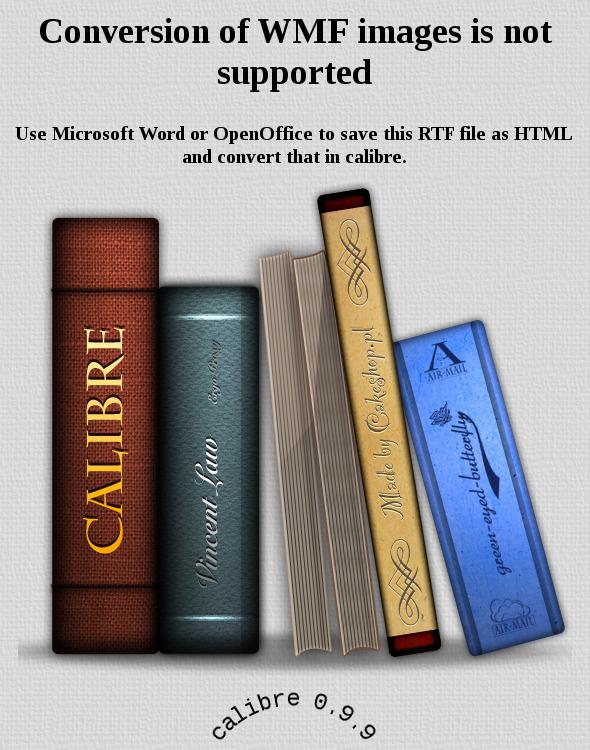![Die Liebe in den Zeiten der Cholera]()
Die Liebe in den Zeiten der Cholera
begonnenen Brief unterbrach, um sie ein letztes Mal anzusehen.
»Denk mit einer Rose an mich«, hatte er gesagt. Kurz nach Mitternacht war sie heimgekommen. Sie legte sich dann angezogen aufs Bett und rauchte, zündete eine Zigarette an der anderen an, um ihm Zeit zu geben, den Brief, von dem sie wußte, daß er lang und schwierig war, zu beenden, und kurz vor drei, als die Hunde zu heulen begannen, stellte sie das Wasser für den Kaffee auf den Herd, kleidete sich ganz in Trauer und schnitt im Hof die erste Rose des Morgengrauens. Doktor Urbino war schon bald klargeworden, wie sehr ihm die Erinnerung an diese nicht zu erlösende Frau zuwider sein würde, und er glaubte den Grund dafür zu kennen: Nur eine prinzipienlose Person konnte den Schmerz so willig empfangen.
Bis zum Ende seines Besuchs lieferte sie ihm dafür noch weitere Argumente. Sie werde nicht zur Beerdigung gehen, weil sie es ihrem Geliebten so versprochen habe, obgleich Doktor Urbino Gegenteiliges aus einem Absatz des Briefes entnommen zu haben glaubte. Sie werde keine Tränen vergießen, und sie werde die ihr verbleibenden Jahre nicht im fauligen Saft ihrer Erinnerungen schmoren, sie werde sich in diesen vier Wänden nicht lebendig begraben, um, wie es von den einheimischen Witwen erwartet wurde, ihr Leichentuch zu nähen. Sie wollte Jeremiah de Saint-Amours Haus, das jetzt, wie es der Brief bestimmte, mit allem Inventar ihr gehörte, verkaufen und klaglos wie immer weiterleben, wo sie glücklich gewesen war, in diesem Sterbequartier der Armen. Dieser Satz verfolgte Doktor Juvenal Urbino auf seinem Heimweg: »Dieses Sterbequartier der Armen.« Das war keine unverdiente Bezeichnung. Denn die Stadt, seine Stadt, war die gleiche geblieben am Rande der Zeit: Die gleiche glühende und ausgedörrte Stadt seiner nächtlichen Ängste und der einsamen Lüste der Pubertät, wo die Blumen oxydierten und das Salz sich zersetzte, eine Stadt, der in vier Jahrhunderten nicht mehr eingefallen war, als langsam zwischen welkem Lorbeer und fauligen Gewässern zu altern. Im Winter überschwemmten reißende Platzregen die Kloaken und verwandelten die Straßen in ekelerregende Kotpfade. Im Sommer drang ein unsichtbarer Staub, rauh wie glühende Kreide, sogar durch die gesichertsten Ritzen der Imagination, aufgestört von wahnsinnigen Winden, die Häuser abdeckten und Kinder in die Lüfte wirbelten. Jeden Samstag verließ das Bettelvolk der Mulatten im Tumult seine Hütten aus Dachpappe und Wellblech am Ufer der Moraste und nahm samt Haustieren und allem Drum und Dran zum Essen und Trinken im Jubelsturm die steinigen Strande der Kolonialstadt. Bis vor wenigen Jahren konnte man noch ein paar alte Männer sehen, die das mit glühenden Eisen eingebrannte Sklavenzeichen auf der Brust trugen. Das Wochenende über tanzten alle gnadenlos, besoffen sich tödlich mit hausgebranntem Schnaps, gaben sich der freien Liebe zwischen dem Icaco-Gestrüpp hin und lösten sonntags um Mitternacht ihre eigenen Fandangos in blutigen Schlägereien auf, in denen dann jeder gegen jeden kämpfte. Es war die gleiche ungestüme Menschenmenge, die sich den Rest der Woche über mit fliegenden Ständen von allem, was nur irgendwie kauf- und verkaufbar war, auf den Plätzen und Gäßchen der Altstadt drängte und dieser toten Stadt die Tollheit eines Menschenmarktes verlieh, der nach gebackenem Fisch roch: ein neues Leben. Die Unabhängigkeit von der spanischen Herrschaft und später dann die Abschaffung der Sklaverei beschleunigten die ehrenhafte Dekadenz, in der Doktor Juvenal Urbino geboren und groß geworden war. Die vormals mächtigen Familien tauchten in das Schweigen ihrer ungeschützten Stadtburgen. In den verwinkelten Kopfsteinpflastergassen, die sich bei Kriegsüberfällen und bei den Landungen der Freibeuter als so vorteilhaft erwiesen hatten, wuchs das Unkraut über die Balkone herunter und sprengte selbst bei den gepflegtesten Häusern Risse in die festgemauerten Wände, und um zwei Uhr nachmittags waren die schleppenden Klavierübungen im Dämmer der Siesta das einzige Lebenszeichen. Drinnen in den kühlen, weihrauchgesättigten Schlafzimmern schützten sich die Frauen vor der Sonne wie vor einer schändlichen Ansteckung, und sogar bei den Frühmetten deckten sie das Gesicht mit einer Mantilla ab. Ihre Liebesgeschichten waren langsam und verwickelt, oft gestört von düsteren Voraussagen, und das Leben erschien ihnen endlos. Wenn der Abend kam und der Straßenverkehr beklemmend wurde,
Weitere Kostenlose Bücher