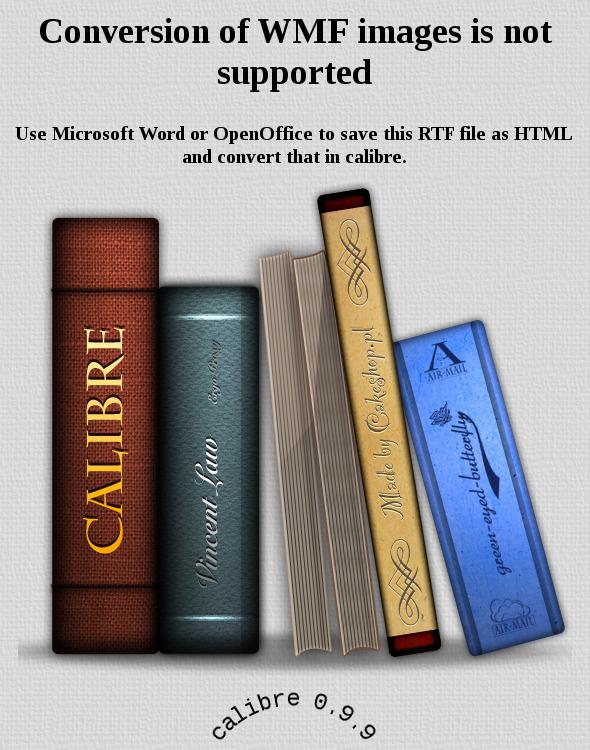![Die Liebe in den Zeiten der Cholera]()
Die Liebe in den Zeiten der Cholera
de Saint-Amour kein guter Umgang war. Juvenal Urbinos besonderer Tag war der Sonntag. Er besuchte das Hochamt in der Kathedrale, kehrte dann nach Hause zurück, blieb dort, ruhte sich aus und las auf der Terrasse des Patios. Nur selten machte er an einem Feiertag einen Krankenbesuch, es mußte sich schon um einen ausgesprochenen Notfall handeln, und seit vielen Jahren kam er auch keiner gesellschaftlichen Verpflichtung mehr nach, es sei denn, sie wäre zwingend gewesen. An jenem Pfingsttag fielen durch einen außerordentlichen Zufall zwei seltene Begebenheiten zusammen: der Tod eines Freundes und das Jubiläum eines hervorragenden Schülers. Statt jedoch, nachdem er den Tod von Jeremiah de Saint-Amour beurkundet hatte, ohne Umweg nach Hause zu fahren, wie er es vorgehabt hatte, ließ er sich von der Neugier forttreiben. Sobald er in die Kutsche gestiegen war, überflog er noch einmal den Abschiedsbrief und wies den Kutscher an, ihn zu einer schwer erreichbaren Adresse irgendwo im alten Sklavenviertel zu fahren. Dieser Entschluß paßte so gar nicht zu seinen sonstigen Gewohnheiten, daß der Kutscher sich vergewisserte, ob kein Irrtum vorlag. Nein, die Adresse war eindeutig, und derjenige, der sie geschrieben hatte, hatte guten Grund, sie genau zu kennen. Doktor Urbino widmete sich dann wieder der ersten Seite und tauchte erneut in diese Quelle der unliebsamen Offenbarungen ein, die sein Leben sogar noch in seinem Alter hätten ändern können, wäre er nur sicher gewesen, daß es sich nicht um die Delirien eines Verlorenen handelte.
Der Himmel hatte sich schon früh eingetrübt, jetzt war er bedeckt und die Luft kühl, aber vor Mittag drohte kein Regen. Der Kutscher versuchte den Weg abzukürzen und begab sich auf die Kopfsteinpflastergassen der alten Kolonialstadt. Mehrmals mußte er im Gedränge der Schulklassen und religiösen Kongregationen, die von der Pfingstliturgie zurückkehrten, anhalten, damit das Pferd nicht scheute. Die Straßen waren voller Papiergirlanden, Musik und Blumen, und von den Balkons verfolgten Mädchen unter ihren bunten, mit Musselinvolants besetzten Sonnenschirmen den Festzug. Nach der Messe stauten sich die Automobile auf der Plaza de la Catedral, wo die Statue des Befreiers kaum zwischen afrikanischen Palmen und neuen Straßenlaternen auszumachen war, und in dem ehrwürdigen und lauten Café de la Parroquia war nicht ein Platz mehr frei. Die einzige Pferdekutsche war die von Doktor Urbino, und sie fiel unter den wenigen, die es in der Stadt überhaupt noch gab, auf, weil das Lacklederverdeck seinen Glanz bewahrt hatte, die Messingbeschläge nicht vom Salpeter zerfressen waren und man Räder und Speichen rot angestrichen und mit Goldschnörkeln verziert hatte wie für einen Galaabend an der Wiener Oper. Während die vornehmsten Familien sich damit zufriedengaben, daß ihre Kutscher ein sauberes Hemd trugen, verlangte er von seinem die Livree aus mattem Samt und den Zylinder eines Zirkusdompteurs, was nicht nur anachronistisch war, sondern in der Bruthitze der Karibik auch als Mangel an Barmherzigkeit galt.
Trotz seiner geradezu manischen Liebe zu der Stadt und obwohl er sie so gut wie kein anderer kannte, hatte Doktor Juvenal Urbino nur selten wie an jenem Sonntag Anlaß gehabt, sich ohne Vorbehalt in das Getümmel des alten Sklavenviertels zu wagen. Der Kutscher mußte mehrere Runden drehen und nachfragen, bis er die Adresse gefunden hatte. Doktor Urbino erkannte von nahem die Schwermut der Sumpflagunen wieder, ihre unheilvolle Stille, diese Blähungen eines Ertrunkenen, die so oft in schlaflosen Morgenstunden vermischt mit den Düften der Jasminsträucher im Hof bis zu seinem Zimmer aufstiegen und die er vorbeistreichen spürte wie einen Wind von gestern, der nichts mit seinem Leben zu tun hatte. Doch jene vom Heimweh oft verklärte Pestilenz hatte plötzlich eine unerträgliche Gegenwärtigkeit, als der Wagen durch die Schlammpfützen der Straßen zu rumpeln begann, wo die Geier sich um die von Ebbe und Flut mitgeschleiften Schlachthofabfälle stritten. Im Unterschied zu der Stadt der Vizekönige mit ihren Steinbauten waren hier die Häuser aus verblichenem Holz errichtet und hatten Weißblechdächer. Die meisten standen auf Pfählen, damit bei Hochwasser nicht die Abwässer aus den offenen Kloaken, einem Erbe der Spanier, hereingespült würden. Alles machte einen ärmlichen und verwahrlosten Eindruck, aber aus den schäbigen Kneipen donnerte Parrandamusik, dort feierten die Armen
Weitere Kostenlose Bücher