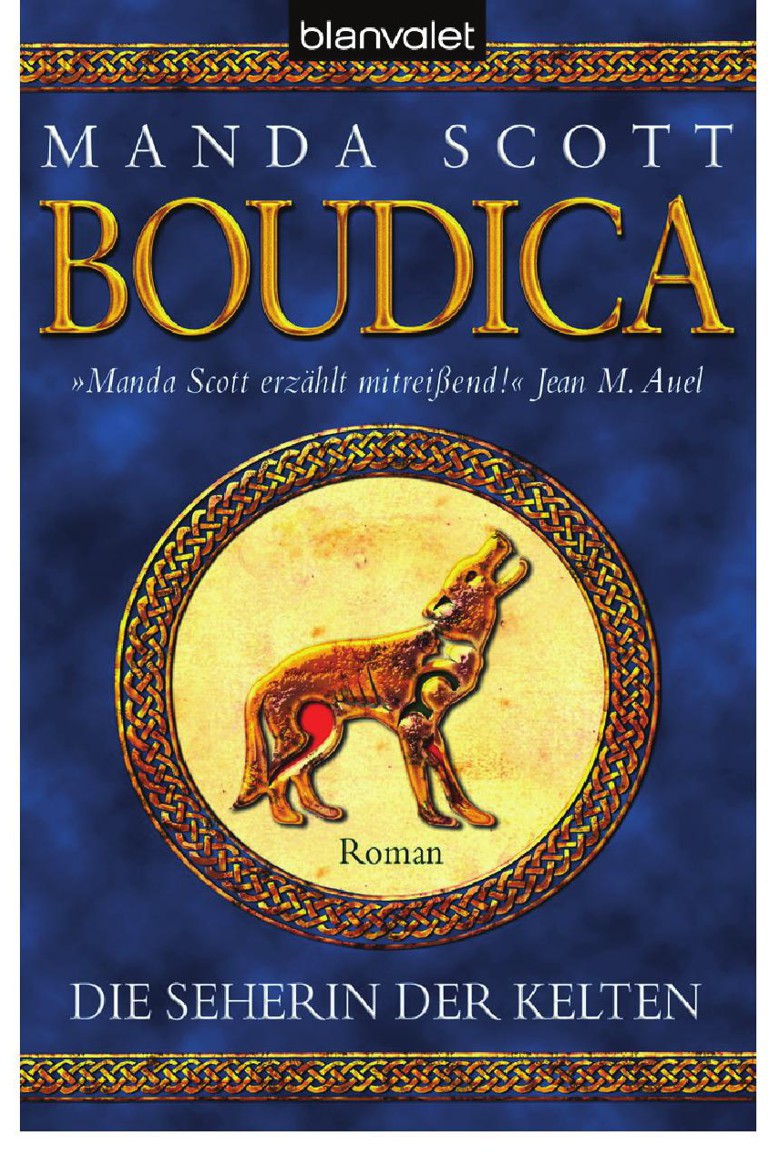![Die Seherin der Kelten]()
Die Seherin der Kelten
Gesichtshälfte verlief eine Prellung, dort, wo die Kante eines Schildes sie gestreift hatte. Über Nacht würde sich die Stelle schwarz verfärben und ihr Gesicht damit einen Monat lang dunkel überziehen. Ihr linkes Handgelenk war stark genug geschwollen, um gebrochen zu sein. Es würde bald verbunden werden müssen, wenn es sich nicht versteifen sollte. Und sie saß auf ihrem Pferd, als ob beides für sie ganz alltäglich wäre. Nachdenklich blickte Madb zu ihm hinab.
»Natürlich wusste ich das. Wie könnte ich das auch nicht wissen? Du brauchst keinen roten Hund auf grauem Grund, um anzuzeigen, wer du bist. Das ist doch jedem einzelnen Teil deines Körpers geradezu aufgeprägt. ›Valerius von den Eceni‹. Der Mann, der auf beiden Seiten kämpft und doch keine von beiden liebt. Mit der Ausnahme, dass er zumindest einen Teil der einen Seite noch immer zu lieben scheint. Wusste er Bescheid?«
»Longinus? Vielleicht früher einmal. Jetzt aber nicht mehr.«
»Dann solltest du besser zu ihm gehen und es ihm erzählen, ehe Braint entscheidet, dass selbst vier Dutzend lebende Thraker noch nicht genug sind, sondern dass es sie auch noch nach einem Kopf verlangt, den sie auf einen Pfahl aufspießen kann, um Rom damit zu verdeutlichen, welches Schicksal es noch erwartet.« Madb schürzte die Lippen. »Ich habe gesehen, wie du heute Nachmittag auf dem Kriegerpferd dein Talent bereits recht eindrucksvoll unter Beweis gestellt hast. Aber auf einem folgsamen Pferd ist das schließlich auch einfach; bei einem Pferd, das einen töten will, wird es da schon schwieriger. Was meinst du, könntest du es auch bei diesem Tier hier schaffen, wenn ich seine Aufmerksamkeit auf mich lenken würde?«
»Wir können es ja mal probieren.«
Das war die einzige wirkliche Chance, und genau seit dem Ende der Schlacht hatte Valerius allein hierauf hingearbeitet. Nun, da sie offen davon sprachen, fiel ihm diese Vorstellung allerdings nicht mehr ganz so leicht. Seine Handinnenflächen waren feucht vor Schweiß. Er wischte sie an seiner Tunika ab.
Das Krähenpferd spürte, wie Valerius es zunehmend eindringlicher betrachtete, und wirbelte herum, stellte sich ihm frontal gegenüber. Seine Flanken hoben und senkten sich, und seine Nüstern schimmerten rötlich, sogen die Luft förmlich in sich hinein. Gefährlich wie eine Wildkatze peitschte es mit dem Schweif hin und her. Seine Augen waren rot geädert vor Staub und vor Zorn und von seinem Abscheu dagegen, umzingelt zu sein. Mehr als jedes andere Tier begriff dieses Pferd das Wesen einer Schlacht, das Anschwellen und Abschwellen der Erregung. Niemals, zumindest so lange Valerius es geritten hatte und soweit es die bedeutenderen Phasen einer Schlacht betraf, hatte es auf der Verliererseite gestanden, und niemals in seinem ganzen Leben hatte es sich vom Feind einfangen lassen.
Valerius konnte einfach nicht glauben, dass der Hengst durch und durch böse sei, sondern nur, dass er ihn persönlich hasste. Und er wollte glauben, dass das Pferd auch Longinus so inbrünstig gehasst hatte wie ihn; wünschte sich in dem gleichen Atemzug, dass es auch ihn, Valerius, genauso rigoros beschützt hätte wie Longinus, wäre er jemals in einer Schlacht gefallen. Er begann, zu dem Hengst zu sprechen, in der Sprache der Ahnen, die er auch ganz zu Anfang gebraucht hatte, damals, als er und das Tier sich gerade erst begegnet waren. Damals, als er noch der Sklavenjunge gewesen war, der stetig nach einer Fluchtmöglichkeit gesucht hatte, und das Pferd wiederum ein gerade erst gezähmtes Hengstfohlen gewesen war, das verkauft werden sollte und das er darum in eine Arena und vor eine nach Blut dürstende Menschenmenge hatte führen müssen. Damals hatte er ihnen zum ersten Mal gezeigt, dass dieses Pferd das Zeug zu einem wahren Schlachtross besaß. Damals hatte er das Tier geliebt und gedacht, dass es eines Tages auch ihn lieben würde. Sein halbes Leben war darüber verstrichen, während er noch immer darauf wartete.
Valerius warf einen weiteren Kiesel in Richtung des Tieres, doch das Pferd ignorierte ihn gänzlich. Dann warf er eine ganze Hand voll nach Longinus’ Körper, und dieses Mal war er sich sicher, dass den Thraker ein leichtes Schaudern durchlief. Diese Gewissheit gab ihm Hoffnung. Seine ganze Aufmerksamkeit allein auf das Tier konzentriert, das ihm nach dem Leben trachtete, tastete er sich weiter vor und rezitierte dabei leise Schlaflieder in der Sprache der Ahnen. Als er eines dieser Lieder etwa halb
Weitere Kostenlose Bücher