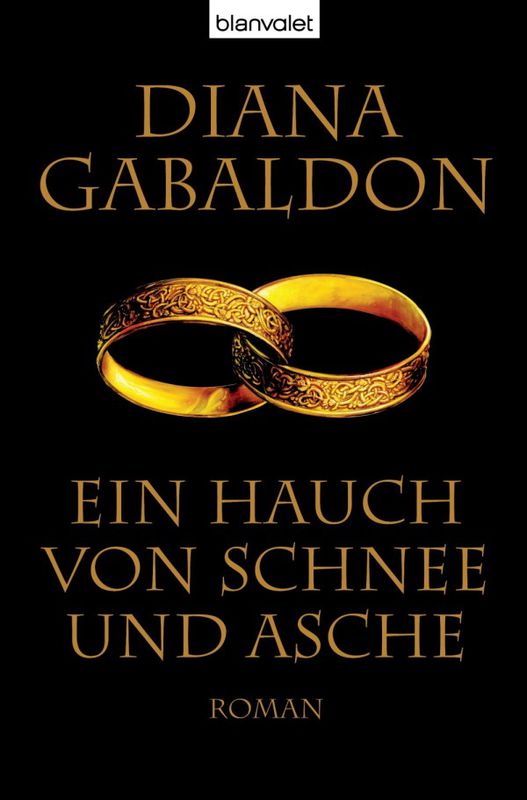![Ein Hauch von Schnee und Asche]()
Ein Hauch von Schnee und Asche
wahr – was sie über die Indianer sagt?«
»Wenn sie sagt, dass sie im Lauf des nächsten Jahrhunderts oder so weitgehend ausgerottet werden – ja, da hat sie Recht.« Ich strich sein Haar glatt, dann setzte ich mich ihm gegenüber auf das Bett und begann, mir selbst das Haar zu bürsten. »Machst du dir deswegen Gedanken?«
Er runzelte ein wenig die Stirn, während er darüber nachdachte, und kratzte sich geistesabwesend an der Brust, deren gelockte, rotgoldene Haare aus seinem offenen Halsausschnitt lugten.
»Nein«, sagte er langsam. »Nicht genau deswegen. Es ist ja nicht so, dass ich sie mit meinen eigenen Händen ins Jenseits befördern würde. Aber … allmählich ist es so weit, nicht wahr? Der Zeitpunkt, an dem ich vorsichtig vorgehen muss, wenn ich mich zwischen den Fronten bewegen will.«
»Ich fürchte, ja«, sagte ich, und eine beklommene Anspannung setzte sich zwischen meinen Schulterblättern fest. Ich verstand nur zu deutlich, was er meinte. Die Frontverläufe waren noch nicht klar – aber sie wurden bereits festgelegt. Im Auftrag der Krone Indianeragent zu werden, bedeutete, dem Anschein nach Loyalist zu sein – schön und gut für den Moment, da die Rebellenbewegung nicht mehr als eine radikale Randerscheinung war, die in Nestern der Unzufriedenheit auftrat. Doch sehr, sehr gefährlich, da wir uns dem Punkt näherten, an dem die Unzufriedenen die Macht an sich rissen und die Unabhängigkeit erklärten.
Da er wusste, wie die Sache ausgehen würde, durfte Jamie nicht zu lange damit warten, sich auf die Seite der Rebellen zu schlagen – doch wenn er es zu früh tat, riskierte er es, wegen Hochverrats festgenommen zu werden. Keine guten Aussichten für einen Mann, der bereits ein begnadigter Hochverräter war.
»Wenn du natürlich Indianeragent würdest «, sagte ich trotzig, »könntest du ja möglicherweise den einen oder anderen Stamm überreden, die amerikanische Seite zu unterstützen – oder sich zumindest neutral zu verhalten.«
»Das könnte ich vielleicht«, pflichtete er mir mit einem gewissen trostlosen Unterton bei. »Aber ganz abgesehen von der Frage nach der Ehrenhaftigkeit einer solchen Vorgehensweise – das würde doch mit dazu beitragen, sie dem Untergang zu weihen, oder? Glaubst du, ihnen würde das Gleiche bevorstehen, wenn die Engländer gewinnen würden?«
»Sie werden nicht gewinnen«, sagte ich mit leicht gereiztem Unterton.
Er sah mich scharf an.
»Ich glaube dir«, sagte er mit einem ähnlichen Unterton. »Ich habe allen Grund dazu, aye?«
Ich nickte mit zusammengepressten Lippen. Ich wollte nicht über den Aufstand in der Vergangenheit sprechen. Genauso wenig wollte ich über die bevorstehende Revolution sprechen, aber uns blieb kaum eine Wahl.
»Ich weiß es nicht«, antwortete ich und holte tief Luft. »Man kann es nicht sagen – da es ja nicht so gekommen ist -, aber wenn ich raten sollte … dann glaube ich, dass es den Indianern unter britischer Regierung sehr wahrscheinlich besser ergehen würde.« Ich lächelte ihn ein wenig reumütig an.
»Ob du es glaubst oder nicht, es ist dem britischen Empire im Großen und Ganzen gelungen – oder es wird ihm gelingen, sollte ich sagen -, seine Kolonien zu verwalten, ohne deren Eingeborene vollständig auszulöschen.«
»Die Menschen in den Highlands ausgenommen«, sagte er ausgesprochen trocken. »Aye, ich glaube es dir, Sassenach.«
Er stand auf, fuhr sich mit der Hand durchs Haar, und mir fiel die winzige weiße Strähne ins Auge, die es durchzog, eine bleibende Erinnerung an eine Schusswunde.
»Du solltest dich mit Roger darüber unterhalten«, sagte ich. »Er weiß eine Menge mehr als ich.«
Er nickte, erwiderte aber nichts, sondern zog nur eine kleine Grimasse.
»Apropos Roger, was glaubst du, wohin er mit Brianna gegangen ist?«
»Zu den McGillivrays, nehme ich an«, erwiderte er überrascht. »Um Jem zu holen.«
»Woher weißt du das?«, fragte ich, nicht minder überrascht.
»Wenn sich Unheil zusammenbraut, hat ein Mann seine Familie gern sicher im Blick, aye?« Er zog eine Augenbraue hoch und sah mich an, dann streckte er den Arm aus und holte sein Schwert vom Kleiderschrank. Er zog
es halb aus der Scheide, dann schob er es wieder hinein und legte die Scheide mit gelockertem, greifbarem Schwert sacht wieder an ihren Platz.
Er hatte eine geladene Pistole mitgebracht; sie lag auf dem Waschtisch am Fenster. Auch Gewehr und Vogelflinte waren geladen und hingen an ihren Haken über dem Kamin.
Weitere Kostenlose Bücher