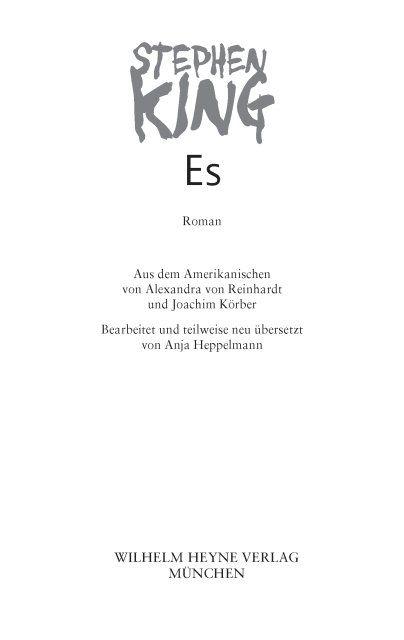![Es: Roman]()
Es: Roman
Richtung, die man ursprünglich einschlagen wollte, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist aber letzten Endes die Stimme, die die Geschichten erzählt, wichtiger als die Geschichten selbst.
Es ist seine Stimme, an die ich mich am besten erinnere: die tiefe Stimme meines Vaters, seine langsame Sprechweise, wie er manchmal kicherte oder laut lachte. Die Pausen, um seine Pfeife anzuzünden oder sich zu schnäuzen oder eine Dose Narragansett aus dem Kühlfach zu holen. Jene Stimme, die für mich irgendwie die Stimme all der Jahre ist, die ausschlaggebende Stimme dieses Ortes – eine Stimme, die ich weder in den Interviews von Ives noch in den paar armseligen Geschichtsbüchern über diesen Ort wiederfinde … und ebenso wenig auf meinen eigenen Tonbändern.
Die Stimme meines Vaters.
Jetzt ist es zehn Uhr abends, die Bücherei ist seit einer Stunde geschlossen, draußen heult der Wind, und der Schneeregen trommelt gegen die Fenster und auf den verglasten Korridor, der zur dunklen, stillen Kinderbücherei führt. Ich höre auch wieder jene anderen Geräusche – leises Knarren außerhalb des Lichtkreises, wo ich sitze und auf gelbes Papier schreibe. Ich sage mir, dass es nur die üblichen Geräusche in einem alten Gebäude sind … aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich frage mich, ob irgendwo dort draußen im Sturm heute Abend ein Clown Ballons an den Mann bringt.
Nun, wie dem auch sei, ich werde jetzt endlich die letzte Geschichte meines Vaters zu Papier bringen. Ich hörte sie in seinem Krankenhauszimmer, knapp sechs Wochen vor seinem Tod.
Ich besuchte ihn zusammen mit meiner Mutter jeden Nachmittag direkt nach der Schule und jeden Abend noch einmal allein. Abends musste meine Mutter daheimbleiben und die Hausarbeit erledigen, aber sie bestand darauf, dass ich hinging. Ich fuhr immer mit dem Rad. Per Anhalter zu fahren, traute ich mich nicht, obwohl die Morde schon vor vier Jahren aufgehört hatten.
Das waren schwere sechs Wochen für einen erst fünfzehnjährigen Jungen. Ich liebte meinen Vater, aber es kam so weit, dass ich diese Abendbesuche hasste – ihn zusammenschrumpfen zu sehen, zu beobachten, wie sein Gesicht von immer tieferen Falten durchfurcht wurde. Manchmal weinte er vor Schmerzen, obwohl er sich krampfhaft bemühte, die Tränen zu unterdrücken. Und auf dem Heimweg wurde es dunkel, und ich dachte zurück an den Sommer von 1958, und ich hatte Angst, mich umzudrehen, weil hinter mir dieser Clown sein konnte... oder der Werwolf... oder Bens Mumie... oder mein Vogel. Aber welche Gestalt Es auch immer annehmen würde – Es würde das vom Krebs gezeichnete Gesicht meines Vaters haben. Deshalb trat ich immer schneller in die Pedale und kam mit hochrotem Kopf, komplett verschwitzt und völlig außer Atem zu Hause an, und meine Mutter fragte dann: »Warum fährst du nur so schnell, Mikey? Du wirst mir noch krank werden.« Und ich antwortete: »Ich wollte möglichst schnell heimkommen, um dir noch bei der Hausarbeit helfen zu können«, und dann umarmte und küsste sie mich und sagte, ich sei ein guter Junge.
Im Laufe der Zeit wusste ich kaum noch, worüber ich mich mit meinem Vater unterhalten sollte. Auf dem Weg in die Stadt zerbrach ich mir den Kopf über mögliche Gesprächsthemen. Ich hatte riesige Angst vor dem Moment, wenn wir beide nicht mehr wussten, was wir sagen sollten. Sein Sterben machte mich zornig und traurig, aber es war mir auch unangenehm; damals wie heute war ich der Meinung, dass – wenn die Menschen schon sterben müssen – es wenigstens schnell gehen sollte. Der Krebs brachte meinen Vater nicht nur um – er erniedrigte ihn auch noch.
Wir sprachen nie über den Krebs, und jedes Mal, wenn sich zwischen uns dieses bedrückende Schweigen ausbreitete, hatte ich das Gefühl, als müssten wir nun gleich darüber sprechen, als gäbe es kein anderes Thema mehr, wie bei Kindern, die »Reise nach Jerusalem« spielen und bei dem zwangsweise immer ein Kind ohne Stuhl übrig bleibt. Ich bemühte mich krampfhaft, etwas zu sagen – irgendetwas! -, nur damit wir nicht über die Krankheit sprechen mussten, die meinen Vater vernichtete, der doch einst Butch Bowers bei den Haaren gepackt und ihm eine Flintenmündung unters Kinn gepresst hatte. Gleich würden wir gezwungen sein, darüber zu sprechen, dachte ich, und dann würde ich weinen. Ich würde meine Tränen nicht unterdrücken können. Und mit meinen fünfzehn Jahren war mir der Gedanke, vor meinem Vater zu weinen, einfach
Weitere Kostenlose Bücher