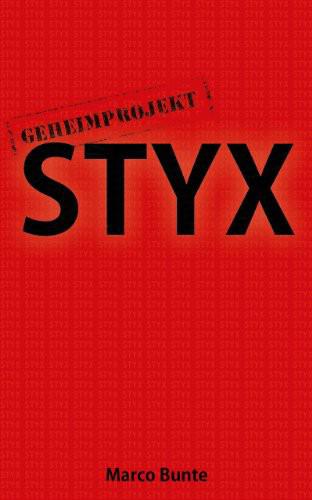![Geheimprojekt Styx]()
Geheimprojekt Styx
steuerte seinen Wohnbereich im ersten Stock an. Den Kleidungsinhalt der Reisetasche versenkte er geschlossen in einer Wäschetonne, die, meist abends, vom Hauspersonal ausgeleert und hinunter zum Wäscheraum gebracht wurde. Dort unten standen rund zwanzig große Waschmaschinen, um der Schmutzwäsche des gesamten Gutspersonals Herr zu werden.
Hendricks legte sich eine graue Jeans, schwarze Sportsocken, dazu Unterwäsche und ein dunkelblaues Anzughemd heraus, dann trat er unter die Dusche und stellte die Temperatur auf die maximale Wärmeeinstellung. Heißer Dampf stieg auf und ein Kribbeln lief über seine Haut, doch er begann sich sofort besser zu fühlen.
Rund zehn Minuten später verließ Hendricks die Dusche und begann in seine Kleidung zu schlüpfen. Anders als beispielsweise Walter Mangope war Hendricks kein ausladender Muskelberg, dessen Schultern eine enorme Breite erreichten. Zwar war auch er bestens trainiert, doch er fiel eher in die Kategorie der Unauffälligeren. Dennoch sah man ihm seine Leistungsfähigkeit an, er war lediglich nicht mit einem Kleiderschrank vergleichbar.
Hendricks knöpfte sich das Hemd zu, rollte die Ärmel bis zur Hälfte des Unterarms hoch und verließ dann das Haus wieder, um zu Sanchez zu gehen.
Nach seinem Gespräch mit Hendricks war Howell hinunter in den Keller gefahren, was dank des Fahrstuhls ein leichtes Unterfangen war, und hatte die Kommandozentrale aufgesucht. Obwohl bei jeder Operation das jeweilige Team vor Ort eine eigene Schaltstelle errichtete, liefen doch hier sämtliche Fäden zusammen. Bei einem Unternehmen mit rund sechshundert aktiven Kräften, plus noch einmal einhundertfünfzig Technikern und Unterstützungspersonal war es sonst unmöglich, den Überblick zu behalten, wo sich wer gerade befand. Die Zentrale war mit etwa drei Dutzend 40-Zollbildschirmen ausgestattet, hinzu kamen unzählige stationäre Computer und Laptops, genau wie Tablet-PCs. Es waren meist zehn Mitarbeiter in der Zentrale anwesend, wobei sich zwei nur damit beschäftigten, die Statusmeldungen auszuwerten und auf der großen, auf einem 60-Zollbildschirm untergebrachten Karte zu vermerken.
Als Howell hinein rollte, nickten ihm seine Leute respektvoll zu, ließen ihre Arbeit aber keinen Moment aus den Augen.
„Sir“, meldete sich ein Mann Anfang dreißig zu Wort, der die neuesten Aufträge, die meist via
E-Mail oder Anruf eingingen, entgegen nahm. „Wir haben eine Anfrage der Kirche bekommen.“Howell stutzte, Anfragen der Kirche für Rettungsmissionen waren eigentlich recht ungewöhnlich, unterhielten sie doch meist gute Beziehungen zu den jeweiligen Staaten. Allein dies genügte, um ihn neugierig werden zu lassen.
„Lassen Sie hören“, forderte er ihn auf und rollte an den etwas abseits stehenden, großen Konferenztisch heran.
„Das Zielland ist die Demokratische Republik Kongo, die Katholische Kirche hat dort den Kontakt zu einem Priester verloren. Sie fürchten, er ist in der Gewalt von Rebellen.“„Wo dort genau?“, wollte Howell wissen, der schon irgendwie ahnte, dass es im vom Bürgerkrieg ganz besonders gebeutelten Osten des Landes war.
„Osten.“
„Was zahlen sie?“ Obwohl Howell davon überzeugt war, Gutes zu tun und Menschen durch seine Firma zu helfen, war der finanzielle Aspekt stets ein Begleiter. Denn das gesamte Unternehmen musste sich rentieren, Ausrüstung musste erworben werden, Schmiergelder gezahlt werden, die laufenden Unterhaltskosten waren immens.
„Fünfhundert.“
Der Preis stimmt, dachte Howell, also warum nehmen wir die Sache nicht an. Niemand hat verdient, von Rebellen gefangen genommen und weiß der Teufel wie behandelt zu werden. Und ganz besonders nicht in Afrika. Howell erinnerte sich an seine Militärzeit, an die Gräuel, die von beiden Seiten begangen worden waren. Je länger ein Konflikt dauerte, desto brutaler wurde er geführt. Das war schon immer so gewesen, und würde sich wohl auch nie ändern.
„Sagen Sie Rom, wir nehmen uns der Sache an. Sie sollen uns alles schicken, was sie über diesen Priester haben.“
„Wird erledigt.“
Howell lehnte sich in seinem Rollstuhl zurück. Er wusste schon, weshalb die Katholische Kirche gerade die SACS gefragt hatte, ob sie die Rettungsmission übernehmen würden. Zum einen gab es keine Sicherheitsfirma, die sich auf dem afrikanischen Kontinent so gut auskannte wie die SACS, zum anderen war ihr Ruf wohl bekannt. Wenn man eine Rettungsmission zu erledigen hatte, fragte man zuerst die
Weitere Kostenlose Bücher