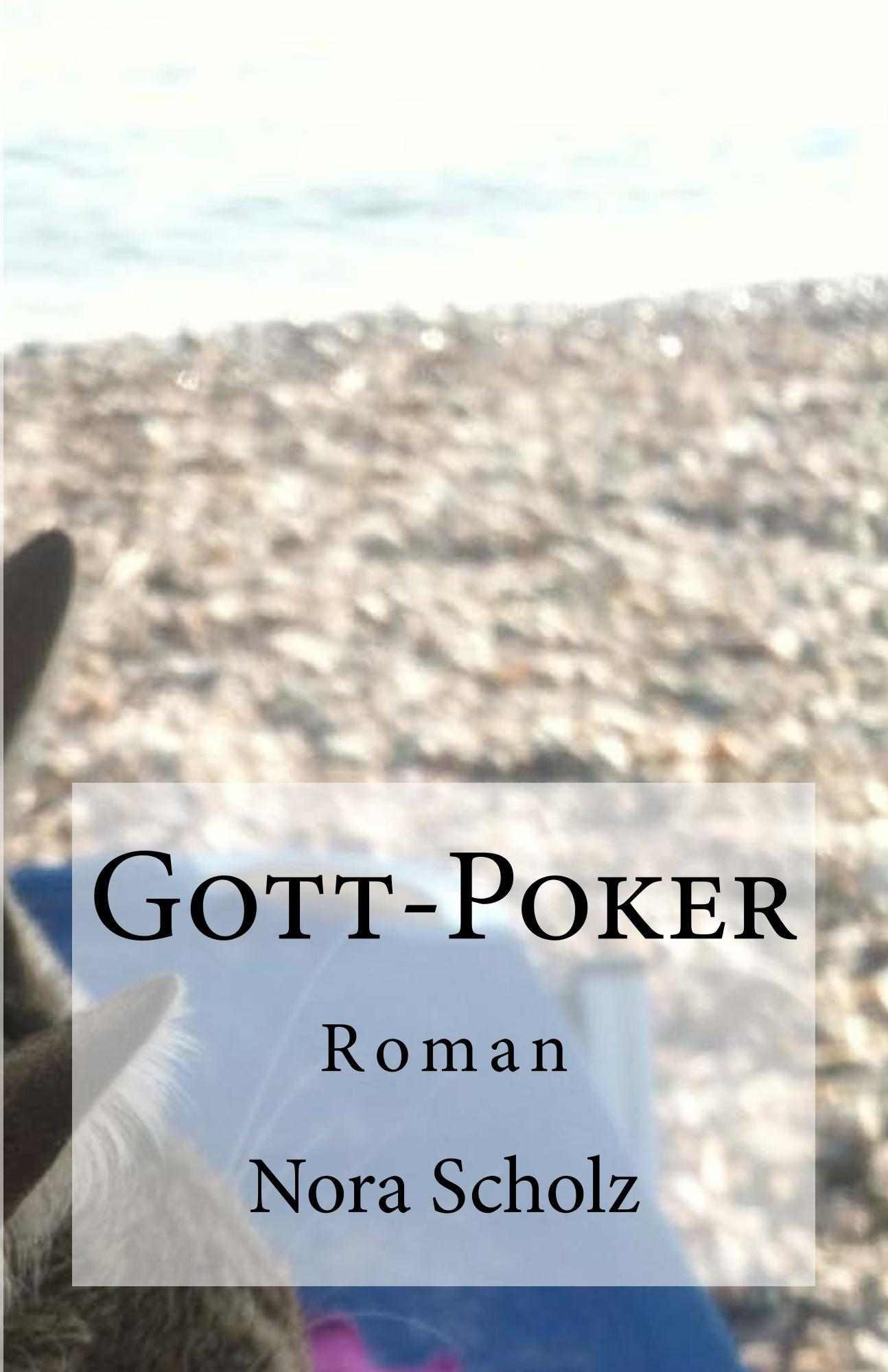![Gott-Poker (German Edition)]()
Gott-Poker (German Edition)
Das satte Krachen, wenn sie mit ungelenken Bewegungen das bereits stumpfe Sägeblatt durch die Oberseite der reglosen Köpfchen reißt, hat etwas Wollüstiges. In ihrem Blick flackert etwas, ein Schimmer, eine verlorene Ahnung der Ewigkeit, die jenseits der brechenden Knochen lauert.
Ihre größte Angst jedoch geht von dem Geräusch aus, das das Skalpell an der Innenseite der Haut ve rursacht, wenn rundum alles ganz still ist und sie das Gewebe abnimmt, um die Beschaffenheit der Hautzellen von unten zu betrachten. Ein kratzendes Schaben, beinahe wie ein Flüstern. Die Härchen auf ihren knochigen Armen, die bis weit über die Handgelenke mit feinrissigen Blättchen aus getrocknetem Blut bespannt sind, stellen sich auf und sie zwingt sich, noch eine Weile weiterzumachen, bevor sie das Messer zur Seite legt und wieder zu Atmen beginnt; ihr Atem durch die Sauerstoffmaske wie das scharfe Ziehen eines Tauchers. Mit einer Pinzette nimmt sie das abgeschabte Gewebe auf und trägt es hinüber ans Fenster, wo das Mikroskop steht. Sie entnimmt das Plexiglasplättchen, klopft sachte die Proben darauf und lässt die Scheibe mit einem Klacken in die Halterung unter der Linse rasten. Sie kauert sich auf den drehbaren Holzhocker, bringt ihn durch eine Beckenbewegung in die richtige Höhe und legt ihr Auge an das kühle Metall des Okulars. Dann stellt sie das Bild scharf. So verweilt sie, manchmal Stunden, bis die Sonne vor dem schmutzerstarrten Fensterglas kapituliert.
Dann richtet sie sich auf, streckt die Arme aus, die Handflächen nach oben, eine Geste, wie um um Verzeihung zu bitten, und geht zum Tisch hinüber. Sie stolpert in der Dämmerung über Schläuche und tastet nach dem Schalter, ein leises Klacken, die Tiere raunen sich zusammen, erschreckt von der plöt zlichen Helligkeit, und die nackte Glühbirne in der gusseisernen Stehlampe findet ihre Doppelung im Fensterglas, das nun nicht mehr in den verwilderten Garten hinauszeigt, sondern sich nach innen richtet und Magdalenas schlanke Gestalt wiedergibt, die sich mit gekrümmtem Rücken über den Tisch beugt und ihr Haar hinter den in die Haut schneidenden Gummiriemen des Mundstückes zurechtrückt. Sie breitet die Haut auf der stählernen Arbeitsplatte aus, streicht sie mit den Händen glatt und legt für einen Moment ihre Wange auf das seidige Fell. Sie schließt die Augen. Ihre Finger tasten nach dem Skalpell. Sie richtet sich auf, und die Haut bäumt sich nach außen, dort, wo das Messer sie teilt, kreuz und quer zieht sie mit unbeherrschten Bewegungen das Messer durch die Haare. Wenn sie das Material durchdrungen hat, ritzt die Klinge den Tisch, das Geräusch wird dringlicher, gewinnt an Intensität, bis die Glasscheiben der Regale zu zittern beginnen, und zarte helle Metallspäne lösen sich aus der speckigen, blutbefleckten Oberfläche der Arbeitsplatte und vermischen sich mit feinen Knochensplittern, mit dem geronnenen Blut und den Haaren der gefangenen Füchse, Kaninchen, Katzen und Eichhörnchen zu einer spröden Masse, aus der sie manchmal kleine Kügelchen formt, die sie gedankenverloren zwischen den Fingerspitzen rollt und dann zu Boden fallen lässt, wo einige der noch wachen Tiere an ihnen schnuppern, ob es vielleicht etwas Essbares wäre. Wenn sie die Klinge zu fest aufdrückt, bricht das Blatt des Skalpells und sie knickt mit dem Handgelenk um, in einer plötzlichen Bewegung wischt sie mit dem Ärmel ihres Kittels die Fellfetzen vom Tisch, so dass sie auf den eisernen Kessel mit den Eingeweiden und zwischen die anderen Tiere fallen, die erschrocken auseinander stoben, und ihr verzweifeltes Schnauben wird von der Maske, die sie jeden Morgen als erstes um ihre Kiefer spannt, zu einem kaum hörbaren Stöhnen gedämpft; ohne Maske ist der Geruch aufgebrochener Körper, die waidwunde Blutluft in dem kleinen Zimmer im Erdgeschoß des alten Hauses längst nicht mehr zu ertragen.
Wenn es an der Tür klopft, zuckt sie zusammen und legt das Messer weg; ihr Blick richtet sich auf Nicolas, der sich ins Zimmer schiebt und den Finger auf den Mund legt. Er stellt einen Sack hin, die hektischen Bewegungen unter der dicken Jute erzählen von der Panik frisch gefangener Tiere. Sie wendet den Blick ab, nimmt von den Sauerstoffflaschen einen zweiten Mundschutz und hält ihn Nicolas entgegen, doch er schüttelt den Kopf, er hat die Lungen draußen unter den Kirschbäumen voll Luft gesogen. Er zieht Magdalena hinter dem Arbeitstisch hervor und reißt ihr den Mundschutz
Weitere Kostenlose Bücher