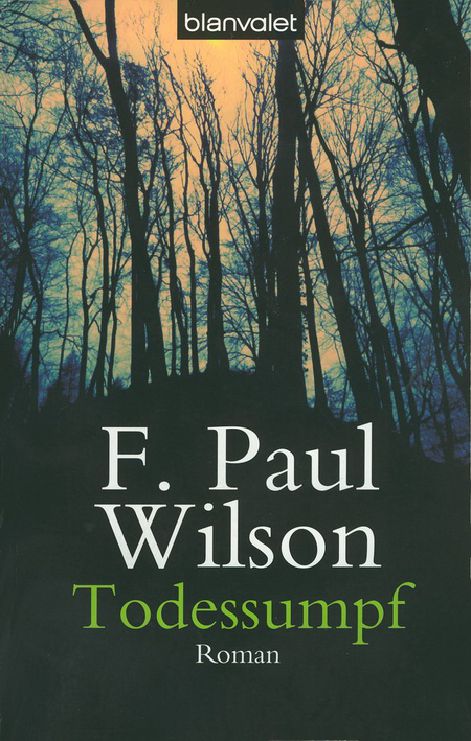![Handyman Jack 07 - Todessumpf]()
Handyman Jack 07 - Todessumpf
konnte, wie er seine Ankündigung verstehen solle. Bereits Sekunden später erschien er wieder, diesmal mit der grauen Stahlkassette, die Jack zu Beginn der Woche am Dienstag gefunden hatte. Er hatte nicht erwartet, sie wieder zu Gesicht zu bekommen. Noch mehr wunderte er sich jedoch über das Kleidungsstück, das sein Vater jetzt trug.
»Dad, soll das ein Witz sein, dass du diesen alten Fetzen rausgesucht hast?«
Sein Vater zog die vorderen Hälften der alten braunen Mohairjacke enger um sich. »Es ist kalt! Das Thermometer draußen an meinem Fenster zeigt gerade mal zwanzig Grad.«
Jack musste lachen. »Weißt du, Dad, in dem Ding siehst du aus wie ein Yeti.«
»Schau einfach drüber hinweg.« Sein Vater stellte die Kassette auf den Tisch. »Setz dich.«
Jack nahm ihm gegenüber Platz. »Was hast du da?«, fragte er und kannte bereits die Antwort.
Dad schloss die Kassette auf und klappte den Deckel hoch. Er fischte eine alte Fotografie heraus und schob sie zu Jack hinüber: Dad und sechs andere junge Männer in Drillichanzügen.
Jack tat so, als würde er das Foto eingehend studieren, so als sähe er es zum ersten Mal.
»Hey. Das ist aus deiner Zeit bei der Army.«
»Army?« Sein Vater verzog geringschätzig das Gesicht. »Bei diesen Heinis? Das sind Marines, mein Sohn. Semper fi und so weiter.«
Jack zuckte die Achseln. »Army, Marines – wo ist der Unterschied?«
»Das würdest du nicht fragen, wenn du jemals zum Corps gehört hättest.«
»Hey, ihr habt doch alle gegen denselben Feind gekämpft, oder etwa nicht?«
»Ja, aber wir waren besser.« Er tippte auf das Foto. »Das waren meine Kriegskameraden.« Seine Miene wurde bitter. »Und ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist.«
Jack betrachtete die jungen Gesichter. Er deutete auf das Foto. »Warum lachen sie alle?«
»Auf dem Foto hatten wir soeben den Scharfschützen-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen.«
Jack schaute vom Foto hoch. »Du warst Scharfschütze?« Er hatte zwar im Laufe der Zeit gelernt, das Unglaubliche als Tatsache hinzunehmen, aber das war nun doch um einiges zu viel. »Mein Vater war Scharfschütze?«
»Sprich es nicht aus, als sei es etwas Schmutziges.«
»Das habe ich auch nicht getan. Ich bin nur … geschockt.«
»Viele Leute schauen auf diese Art des Kriegshandwerks mit Verachtung herab, sogar innerhalb des Militärs. Und seit diese beiden Geisteskranken all diese unschuldigen Menschen in Washington, D.C. getötet haben, tun das auch die meisten Zivilisten. Aber diese beiden Irren waren keine Scharfschützen. Sie haben wahllos gemordet, und damit hat die Tätigkeit eines Scharfschützen nicht das Geringste zu tun. Ein Scharfschütze bezieht nicht seinen Posten, um auf alles zu schießen, was sich bewegt, sondern er nimmt sich ganz spezielle Ziele vor, strategische Ziele.«
»Und das hast du in Korea getan.«
Dad nickte langsam. »Ich habe da drüben sehr viele Männer getötet, Jack. Ich bin sicher, dass es heute noch sehr viele ehemalige oder auch aktive Soldaten gibt, die während ihrer Einsätze mehr Feinde – Deutsche, Japaner, Nordkoreaner, Chinesen, Vietnamesen – getötet haben als ich. Aber sie haben lediglich auf gesichtslose fremde, feindliche Leiber geschossen, die ihrerseits versuchten, sie zu töten. Wir Scharfschützen gingen da ganz anders vor. Wir haben uns gut versteckt und aus dieser Position wichtige Funktionsträger ausgeschaltet. Es kam vor, dass Hunderte, ja, Tausende feindlicher Soldaten keine fünfhundert Meter von unseren Stellungen entfernt waren. Doch uns interessierte nicht eine möglichst große Zahl getöteter Gegner. Wir hatten es auf die Offiziere, die Unteroffiziere und vor allem die Funkspezialisten abgesehen, also auf jeden, dessen Tod die Fähigkeit des Feindes schwächte, einen Angriff zu starten oder in Gang zu halten.«
Jack betrachtete aufmerksam das Gesicht seines Vaters. »Das klingt fast … persönlich.«
»Das ist es auch. Und das ist es, was den Menschen Unbehagen bereitet. Sie finden es unerträglich kaltblütig, ein spezielles Individuum – sagen wir, in einem Militärcamp – auszusuchen, es anzuvisieren und dann den Abzug zu betätigen.« Er seufzte. »Und vielleicht haben sie sogar Recht.«
»Aber wenn dadurch Leben gerettet werden …«
»Es ist immer noch ganz schön kaltblütig, meinst du nicht? Als ich anfing, suchte ich mir Funker oder Geschützbesatzungen, wenn ich keinen Offizier oder Unteroffizier ins Visier nehmen konnte. Aber ich bemerkte, dass
Weitere Kostenlose Bücher