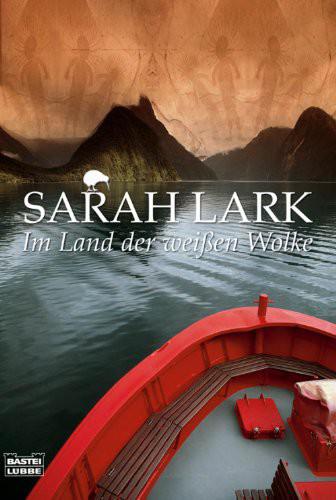![Im Land Der Weissen Wolke]()
Im Land Der Weissen Wolke
Zorn dachte Helen daran, dass ihr Bruder Simon erst letzte Woche wieder durch eine Prüfung gerasselt war.
»Baronets heiraten normalerweise Baronessen«, antwortete sie jetzt ein wenig ungehalten auf Georges Frage. »Und was das hier angeht ...«, sie wies auf das Kirchenblatt, »habe ich den Artikel gelesen, nicht die Anzeige.«
George enthielt sich einer Antwort, grinste aber vielsagend. Der Artikel handelte von Wärmeanwendung bei Arthritis. Sicher hochinteressant für die älteren Mitglieder der Gemeinde, aber Miss Davenport litt bestimmt noch nicht unter Gelenkschmerzen.
Immerhin schaute seine Lehrerin jetzt auf die Uhr und kam dabei zu dem Schluss, den Nachmittagsunterricht doch schon zu beenden. In einer knappen Stunde würde das Abendessen aufgetragen. Und wenn George auch höchstens fünf Minuten brauchte, sich fürs Essen zu kämmen und umzuziehen, und Helen kaum länger benötigte, war es bei William stets eine längere Prozedur, ihn aus dem tintenverschmierten Schulkittel in einen vorzeigbaren Anzug zu stecken. Helen dankte dem Himmel, dass sie wenigstens nicht damit gestraft war, sich um Williams Erscheinungsbild kümmern zu müssen. Das übernahm eine Kinderfrau.
Die junge Gouvernante schloss die Stunde mit allgemeinen Bemerkungen über die Wichtigkeit der Grammatik, denen beide Jungen nur mit halbem Ohr lauschten. Gleich darauf sprang William begeistert auf, ohne seine Hefte und Schulbücher eines weiteren Blickes zu würdigen.
»Ich muss schnell noch Mummy zeigen, was ich gemalt habe!«, verkündete er, womit die Arbeit des Aufräumens erfolgreich auf Helen abgewälzt war. Die konnte schließlich nicht riskieren, dass William in Tränen aufgelöst zu seiner Mutter floh und ihr von irgendwelchen himmelschreienden Ungerechtigkeiten der Lehrerin berichtete. George warf einen Blick auf Williams ungelenke Zeichnung, die seine Mutter gleich sicher mit Begeisterungsausbrüchen quittieren würde, und zuckte resigniert die Schultern. Dann packte er rasch seine Sachen zusammen, bevor auch er hinausging. Helen bemerkte, dass er ihr dabei einen fast mitleidigen Blick zuwarf. Sie ertappte sich dabei, an Georges Bemerkung von eben zu denken: »Wenn Sie keinen Mann finden, müssen Sie sich für den Rest Ihres Lebens mit hoffnungslosen Fällen wie Willy herumärgern.«
Helen griff nach dem Kirchenblättchen. Eigentlich wollte sie es wegwerfen, überlegte es sich dann aber anders. Beinahe verstohlen steckte sie es in die Tasche und nahm es mit auf ihr Zimmer.
Robert Greenwood hatte nicht viel Zeit für seine Familie, doch die gemeinsamen Abendessen mit Frau und Kindern waren ihm heilig. Die Anwesenheit der jungen Gouvernante störte ihn dabei nicht. Im Gegenteil, er fand es oft anregend, Miss Davenport ins Gespräch mit einzubeziehen und ihre Ansichten zu Fragen des Weltgeschehens, der Literatur und der Musik zu erfahren. Miss Davenport verstand deutlich mehr von diesen Dingen als seine Gattin, deren klassische Bildung zu wünschen übrig ließ. Lucindas Interessen beschränkten sich auf den Haushalt, die Vergötterung ihres jüngeren Sohnes und die Mitarbeit in den Damenkomitees diverser Wohltätigkeitsorganisationen.
Auch an diesem Abend lächelte Robert Greenwood freundlich, als Helen eintrat, und schob ihr den Stuhl zurecht, nachdem er die junge Lehrerin förmlich begrüßt hatte. Helen erwiderte das Lächeln, achtete aber darauf, Mrs. Greenwood dabei mit einzuschließen. Auf keinen Fall durfte sie den Verdacht erregen, mit ihrem Arbeitgeber zu flirten, auch wenn Robert Greenwood ein unzweifelhaft attraktiver Mann war. Er war groß und schlank, hatte ein schmales, intelligentes Gesicht und forschende braune Augen. Der braune Dreiteiler mit der goldenen Uhrkette kleidete ihn hervorragend, und seine Manieren standen denen der Gentlemen aus den Adelsfamilien, mit denen die Greenwoods gesellschaftlichen Umgang pflegten, in nichts nach. Ganz anerkannt waren sie in diesen Kreisen allerdings nicht; sie galten als Emporkömmlinge. Robert Greenwoods Vater hatte sein florierendes Unternehmen praktisch aus dem Nichts aufgebaut, und sein Sohn mehrte den Wohlstand und bemühte sich um gesellschaftliches Ansehen. Dazu hatte auch seine Heirat mit Lucinda Raiford beigetragen, die aus einer verarmten Adelsfamilie stammte – was vor allem auf die Vorliebe ihres Vaters für Glücksspiel und Pferderennen zurückzuführen war, wie man in der feinen Gesellschaft munkelte. Mit dem bürgerlichen Stand fand Lucinda sich nur
Weitere Kostenlose Bücher