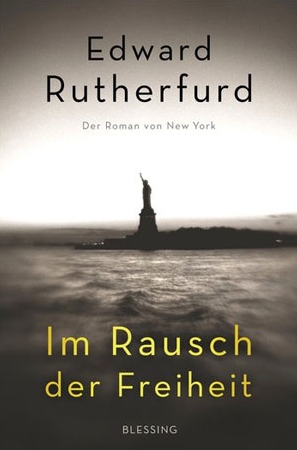![Im Rausch der Freiheit]()
Im Rausch der Freiheit
Übeltäter zum Zweck ihrer öffentlichen Demütigung in den Pranger geschlossen wurden.
»Dort drüben« – er zeigte weiter das Ufer hinauf- »haben wir auch einen Galgen, wo Menschen wegen schwererer Verbrechen mit einem Strick erdrosselt werden.«
»Mein Volk kennt keinen solchen Brauch«, sagte sie.
»Ich weiß«, antwortete er freundlich.
Sie waren gerade kurz vor einer Schenke stehen geblieben, in der einige Seeleute saßen, als ihnen – von ihrem weiten Kleid umflossen, eine Pfeife in der Hand – Margaretha van Dyck entgegengeschlendert kam.
*
Margaretha starrte ihren Mann und das kleine Mädchen an. Es war erst ein paar Minuten her, dass Mijnheer Steenburgens Frau ihr eröffnet hatte, Dirk van Dyck sei in der Stadt. Es konnte auch nur Einbildung gewesen sein, aber als die Frau ihr diese Mitteilung gemacht hatte, meinte Margaretha ein leichtes Funkeln in ihren Augen zu sehen – die Sorte Blick, mit dem man eine verheiratete Frau bedachte, deren Ehemann in Gesellschaft einer anderen Frau gesehen worden war –, und dies hatte sie wachsam gemacht.
Würde Dirk ihr so etwas antun, in aller Öffentlichkeit? Eine plötzliche kalte Angst hatte sie erfasst, aber sie hatte sich zusammengenommen und der Frau zugelächelt, als habe sie ihren Mann ohnehin an diesem Tag erwartet.
Und da stand er mit einem Indianermädchen. Immerhin, sie konnte kaum seine Geliebte sein. Aber für eine reinblütige Indianerin war sie vielleicht etwas … zu blass.
»Du bist wieder da«, sagte sie und umarmte ihn flüchtig. Dann trat sie einen Schritt zurück.
»Ja. Wir haben erst am Lagerhaus abgeladen.«
Sah er nervös aus? Ja, ein wenig, fand sie. »War deine Reise erfolgreich?«
»Sehr sogar. So viele Felle, dass ich zusätzlich ein Indianerkanu brauchte, um sie alle herzuschaffen.«
»Das ist gut.« Sie starrte Bleiche Feder an. »Wer ist dieses Mädchen?«
Dirk van Dyck warf Bleiche Feder einen Blick zu und fragte sich, ob sie den Verlauf des Gesprächs verstand oder erahnte. Ein paar Indianer sprachen Niederländisch, aber seiner Tochter gegenüber hatte er immer ihre Muttersprache verwendet. Er sandte ein stummes Stoßgebet zum Himmel.
»Sie ist mit den Indianern im Kanu mitgekommen«, antwortete er ruhig. »Gehört zum Schildkröten-Clan.«
Bei den dortigen Indianerstämmen wurde die Zugehörigkeit zu einem Clan über die weibliche Linie vererbt. Man gehörte also dem Clan seiner Mutter an.
»Ich stehe mit dem Schildkröten-Clan in freundschaftlichen Beziehungen.«
Margaretha betrachtete Bleiche Feder nachdenklich.
»Kennst du ihre Mutter?«
»Nein.« Van Dyck schüttelte den Kopf. »Sie ist tot.«
»Das Kind sieht wie ein Halbblut aus.«
Hatte sie es erraten? Er spürte Angst in sich aufsteigen, die er aber rasch unterdrückte.
»Finde ich auch.«
»Der Vater?«
»Wer weiß?« Er zuckte die Schultern.
Seine Frau zog an ihrer Pfeife.
»Diese Indianerinnen sind ja alle gleich«, sagte sie abschätzig.
Es war seltsam, überlegte van Dyck. Trotz ihres kalvinistischen Glaubens hatten Niederländerinnen recht oft Liebschaften vor der Heirat, und das wurde toleriert. Aber nur weil ein paar Indianerinnen, deren Volk die Weißen alles abgenommen hatten, jetzt gezwungen waren, in den Hafenstädten für ein paar Münzen, deren Wert sie nicht kannten, ihren Körper zu verkaufen, war seine Frau imstande zu glauben, jede indianische Frau sei eine gewöhnliche Hure.
»Nicht alle«, sagte er ruhig.
»Sie ist ein hübsches Kind.« Margaretha stieß Rauch aus dem Mundwinkel aus. »Jammerschade, dass ihr gutes Aussehen nie lange hält.«
Hatte sie recht? Würde die Schönheit seiner kleinen Tochter schon zu seinen Lebzeiten verblassen?
Er sah, dass Bleiche Feder wie benommen vor sich hinstarrte. Lieber Gott, hatte sie verstanden, was sie sagten? Oder hatte sie es aus dem Ton ihrer Stimmen erraten?
Dirk van Dyck liebte seine Frau. Vielleicht nicht so sehr, wie es sich für einen Ehemann gehörte, aber sie war auf ihre Art durchaus eine gute Frau und ihren Kindern eine gute Mutter. Vermutlich war keine Ehe vollkommen, und woran auch immer es auf seiner Seite hapern mochte – sie war daran ebenso schuld wie er selbst. Er war ihr treu gewesen, meistens jedenfalls – wenn man von Bleiche Feders Mutter absah, und die betrachtete er als einen Sonderfall.
Eigentlich gab es keinerlei Grund, warum Margaretha auf die Idee kommen sollte, Bleiche Feder sei seine Tochter. Keinen Grund außer ihrem weiblichen
Weitere Kostenlose Bücher