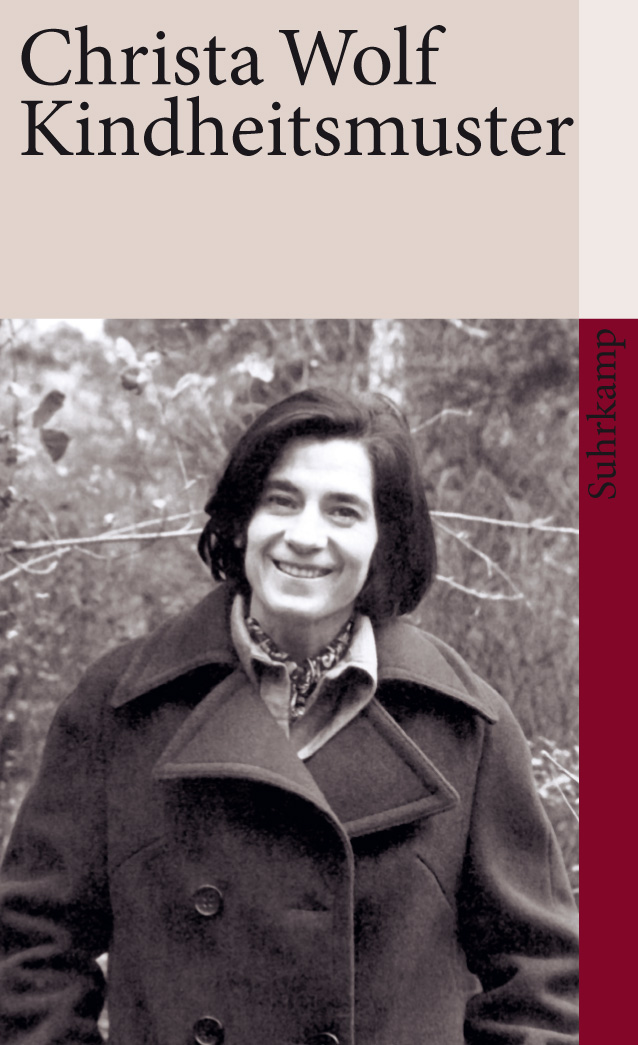![Kindheitsmuster]()
Kindheitsmuster
von Frau Wrunks Pudding. Sie schneidet von der Dauerwurst vom Lande dünne Scheiben ab und ißt sie ohnenennenswerte Gewissensbisse. Frau Wrunks zuerst fragende, später durchdringende Blicke erwidert sie unverfroren. Verdrossen kehrt sie morgens den Teppich in der Wohnstube ab. Die Beziehungen zwischen ihr und der wirklich sehr netten, anständigen Frau Wrunk trüben sich allmählich, schuld ist vor allem die Art und Weise, wie Nelly sich in der Wohnung umsieht. Das muß sich Frau Wrunk nicht bieten lassen für ihre Gutmütigkeit.
Die Schule lag am Pfaffenteich, da liegt sie noch heute. Es gab Schichtunterricht, früh die Jungen, nachmittags die Mädchen, und umgekehrt. Unter den Bänken wurden Briefe liegengelassen: Wenn die Besitzerin dieses Platzes nicht abgeneigt ist ... So wurden Ehen gestiftet. Ute Meiburg, die hinter Nelly saß – sie kam aus Stettin –, hat in dem Briefeschreiber ihren späteren Mann kennengelernt. Hand in Hand gingen sie mittags an den »Bürgerstuben« vorbei – heute ein in ländlichem Holzbankstil renoviertes volkstümliches Lokal –, in denen Nelly an immer dem gleichen Tisch saß und vier glasige Pellkartoffeln in der Einheitssoße drei zerdrückte. Es war ihr unbegreiflich, wie ein unnahbar stolzes Mädchen wie Ute sich auf Grund einer derartigen Annonce mit einem Jungen treffen konnte. Ausführlich besprach sie mit Helene aus Marienburg – die langes schwarzes Haar und tiefblaue Augen hatte, eine seltene, anziehende Mischung – diesen Fall, den sie beide ganz gleich beurteilten, unbeschadet ihrer Freundschaft mit Ute. Alle drei waren sie sich einig, daß ihnen durch Deutschlands Niederlage das Lachen verlorengegangen war. Niemals würden sie sich an die unsinnigen roten Spruchbänder in den Straßen, an die grün gestrichenenZäune um die sowjetischen Objekte, an Hammer und Sichel im Stadtbild gewöhnen. Über die neuen Filme in der »Schauburg«, in die ihre verlegenen Lehrer sie führen mußten, konnten sie nur lauthals und höhnisch lachen. Kein Jahr früher hatten sie in ihren verschiedenen Städten Schlange gestanden, um Kristina Söderbaum in »Die goldene Stadt« zu sehen.
Helenes schöne Augen wurden im Verlauf des Winters immer größer. An einem der ersten warmen Märztage lief sie mitten im Deutschaufsatz an die Wasserleitung, ließ sich den kalten Strahl über die Pulsadern laufen. Maria Kranhold, die Lehrerin, wunderte sich sehr, weil ja die Klasse kaum geheizt war und man in den Mänteln saß. Doch, ihr sei warm, sagte Helene und kippte um. In der großen Pause brachte ihre Mutter ihr eine Scheibe Brot von der neuen Zuteilung. Es stellte sich heraus, daß Helene drei kleinere Geschwister hatte und dazu übergegangen war, immer weniger zu essen.
Der Aufsatz behandelte den Marquis Posa in Schillers »Don Carlos«. Maria Kranhold hatte ihnen ins Gesicht hinein behauptet, dieses Stück sei – wie übrigens auch der »Wilhelm Tell« – in den letzten Jahren des Nationalsozialismus an den deutschen Schulen nicht mehr behandelt worden, schon wegen eines einzigen Satzes: Geben Sie Gedankenfreiheit, Sire! – Alle, besonders aber Ute, Helene und Nelly, hatten diese Behauptung erbittert bestritten. Eine Verleumdung, daß an ihren Schulen nicht der ganze Schiller behandelt wurde.
Nelly gab sich Mühe, einen möglichst doppeldeutigen Aufsatz zu schreiben: Die besondere Freiheitssehnsucht eines jeden Volkes, die von anderen Völkern weder geteilt noch verstanden werden kann, weder frühernoch heute. Was sie ärgerte: Die Zwei bekam sie von der Kranhold nicht wegen des Inhalts, sondern für »geschraubten Stil«. Gegen Ende der Stunde sagte Maria Kranhold in einem anderen Zusammenhang: Ihr wäre es in der braunen Zeit als ein Höhepunkt der Freiheit erschienen, wenn sie die Fahne mit der Spinne nicht hätte grüßen müssen. Sie habe sich diese gefährliche Freiheit genommen, erschlichen, erlistet: Niemals habe sie vor der Hakenkreuzfahne den Arm gehoben. Wenn man »Freiheit« sage, müsse man wenigstens wissen, daß die Freiheit der einen die Unfreiheit der anderen bedeuten könne.
Dergleichen hörte Nelly zum erstenmal von jemandem, der nicht im KZ gesessen hatte. Sie wollte die Kranhold nicht leiden können. Die Kranhold sagte niemals »die Nazis«, wie die anderen. Vor dem Umbruch habe sie »die Nazis« gesagt, jetzt ekele es sie an, wie plötzlich alle dieses Schimpfwort gebrauchten. – Maria Kranhold war eine gläubige Christin. Wenn Sie wollen, sagte sie zu
Weitere Kostenlose Bücher