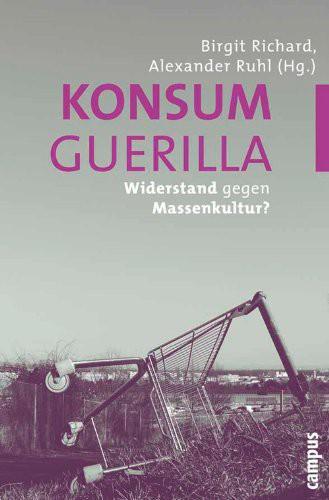![Konsumguerilla - Widerstand gegen Massenkultur]()
Konsumguerilla - Widerstand gegen Massenkultur
Verhältnis von Kultur und sozialer Praxis
, Bielefeld, S. 73–91.
Hövel, Jörg auf dem (2006), »Lass das doch die Community machen« in:
Telepolis,
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/22/22832/1.html, 07. Juni, 04.08.2008.
Institut für Demoskopie Allensbach (2003), »Weniger Markenbewusstsein. Ein Ergebnis der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse«
allensbacher berichte
Nr. 15, http://www.ifd-allensbach.de/pdf/prd_0315.pdf, 23.08.2008.
Näser, Torsten (2008), »Authentizität 2.0 – Kulturanthropologische Überlegungen zur Suche nach ‚Echtheit’ im Videoportal YouTube«
in:
kommunikation@gesellschaft
, Jg. 9, Beitrag 2. Online-Publikation: http://www.soz.uni-frankfurt.de/K. G/B2_2008_Naeser.pdf, 21.08.2008.
Richard, Birgit/Grünwald, Jan/Ruhl, Alexander (2008), »Me, Myself, I: Schönheit des Gewöhnlichen. Eine Studie zu den fluiden
ikonischen Kommunikationswelten bei flickr.com« in: Kaspar Maase (Hg.),
Die Schönheiten des Populären: Ästhetische
Erfahrung der Gegenwart
, Frankfurt/M., S. 114–132.
Rohwetter, Markus (2006), »Vom König zum Knecht« in:
Die Zeit
, 21.September, Nr. 39, http://www.zeit.de/2006/39/Do-it-yourself, 04.08.2008.
Ruhl, Alexander (2008),
Schreiben und Schweigen im virtuellen Raum. Computervermittelte
Kommunikation in kultur- und sozialwissenschaftlicher Forschungskooperation
, Opladen.
Toffler, Alvin (1983),
Die dritte Welle. Zukunftschance. Perspektiven für die Gesellschaft des
21. Jahrhunderts
, München.
Ullrich, Wolfgang (2006),
Habenwollen. Wie funktioniert die Konsumkultur
, Frankfurt/M.
Voß, Günter/Rieder, Kerstin (2005),
Der arbeitende Kunde. Wenn Konsumenten zu unbezahlten
Mitarbeitern werden
, Frankfurt/M.
1
Die Schreibweise mit Binnenmajuskel, über die explizit sowohl weibliche als auch männliche Personengruppen einbezogen werden,
ist nicht elegant, aber soweit eingebürgert, dass sie der Lesbarkeit am ehesten entgegenkommt. Das Binnen-I erweist sich als
weniger sperrig, indem es den Lesefluss geringfügiger unterbricht als eingefügte Schräg- und Bindestriche oder die Nennung
sowohl der weiblichen als auch der männlichen Form.
2
Der Begriff Prosumer ist eine Wortbildung aus producer und consumer und bezeichnet Personen, die gleichzeitig etwas konsumieren
und herstellen (vgl. Toffler 1983). KonsumentInnen werden Teil des Produktionsprozesses und somit zu einem gewissen Grad zugleich
zu Produzenten des Gutes. Eine andere, davon unabhängige Verwendung des Wortes setzt sich aus professional und consumer zusammen
und wird beispielsweise für digitale Kameras benutzt, deren Ausstattung »semiprofessionell« ist. In diesem Fall dient der
Begriff zur Definition eines Marktsegments.
3
Virales Marketing ist bestrebt, Botschaften zu gestalten, die so sehr beeindrucken, dass sie im Bekanntenkreis kommuniziert
werden. Gelingt es, werden massenhaft E-Mails oder Links weitergeleitet, was an die unkontrollierte Ausbreitung einer Virusinfektion
erinnert. Als prominentes Beispiel kann das Computerspiel »Moorhuhn« gelten.
4
Mit buzzword wird ein Schlagwort bezeichnet, das besondere Aufmerksamkeit erwecken soll, etwa, indem augenfällige Bezüge zu
akuten Debatten konstruiert werden.
5
Smart Shopper repräsentieren laut dem Institut für Demoskopie Allensbach ein Viertel der deutschen Gesamtbevölkerung (2003:
5).
6
http://www.eurorscg.de/strategie/prosumer, 04.08.2008.
7
Etwa das Studierenden-Netzwerk StudiVZ, das der Holtzbrinck-Verlag für 85 Millionen Euro übernahm. StudiVZ ließ im Mai 2008
die Seitenaufrufe von der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW) erfassen und
verdrängte mit circa 2,6 Milliarden Seitenaufrufen T-Online (2,2 Mrd.) auf den 2. Platz.
8
Radiosender von Tim Renner, der zuvor Präsident einer deutschen Unternehmenstochter von Universal Music Deutschland war, dem
weltgrößten Tonträgerhersteller unter dem Dach des französischen Vivendi Konzerns.
21
31
21
31
true
|21| Konsum und die Ethnographie des Alltags: Eine fragwürdige Ästhetik der Dinge
Hans Peter Hahn
»Konsum macht dumm« – so könnte man die klassische Position Walter Benjamins (1936) zu Waren und Konsum auf einen Satz bringen.
Seine Studien über die Aura der Dinge und über das Verhältnis von Kunstwerken zu massenhaft reproduzierbaren Gütern zeichnen
eine scharfe Trennlinie: Während das Unikat, das einzelne, vom Künstler angefertigte Objekt oder die künstlerische
Weitere Kostenlose Bücher