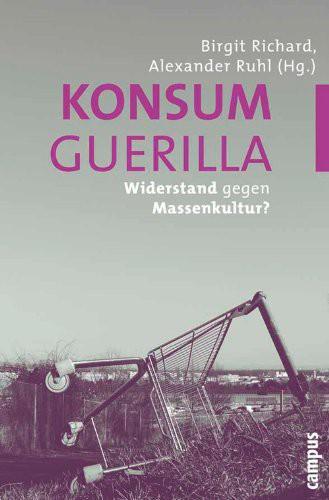![Konsumguerilla - Widerstand gegen Massenkultur]()
Konsumguerilla - Widerstand gegen Massenkultur
eines Radiosenders einbezogen werden, indem sie selbst komponierte Lieder oder selbst verfasste Beiträge einsenden – selbstverständlich
in Kombination mit einem Bewertungssystem. So startete Motor FM 8 zusammen mit My-Space (jetzt im Besitz von Rupert Murdoch) eine Aktion, bei der jungen KünstlerInnen die Chance auf eine
breite Öffentlichkeit via Radio in Aussicht gestellt wurde. Daneben treten Blogs und Podcasts als neue Kommunikationskanäle,
moderiert von BürgerInnen, in Konkurrenz zu den klassischen Printmedien und zum herkömmlichen Hörfunk. Als Alleinstellungsmerkmal
gemeinschaftlich geschaffener Inhalte gilt, trotz gewisser Unprofessionalität und gelegentlichem Mangel an Qualität, der Mythos
»Authentizität« (vgl. Näser 2008). Wobei dieser Begriff im Kontext des Marketings und der Medienwirkungsforschung sehr kritisch
beleuchtet werden muss, da die scheinbar eigenen Aktionen und Bilder der NutzerInnen längst medial überformt und zu Hybriden
aus Eigen- und Fremdbildern geworden sind.
Der für den Streifzug durch denkbare Positionen von KonsumentInnen eingenommene Fokus auf überwiegend medial etablierte soziale
Realitäten und dort manifeste soziale Praktiken folgt der Beobachtung, dass sich hier zentrale Mechanismen gegenwärtiger Gesellschaftsmerkmale
zeigen |17| beziehungsweise ausgehandelt werden. Sie sind nicht als nur immateriell oder virtuell abzuwerten, denn sie bilden einen entscheidenden
Teil der gegenwärtigen Lebenswelt und Kultur, welcher den Horizont für Denken und Handeln darstellt. Haltungen und praktische
Lebensgestaltung gründen so stets auch auf einer durch Medien vermittelten Welt, die die Folie für sinnstiftende Interpretationen
bietet (vgl. Ruhl 2008: 36).
In diesem Sinne ist auch die Konsumguerilla zu verstehen: Ehemals passive EndverbraucherInnen, denen kaum nennenswerte Eigenaktivität
zugebilligt wurde und bei denen man davon ausging, dass sie mit Angeboten des Marktes meist relativ planmäßig umgingen, melden
sich nun weithin vernehmlich zu Wort und vertreten ihre eigene Interpretation der Bedeutungen, die mit Konsumweisen und Produkten
einhergehen. Sie demontieren das Monopol der Angebote, wobei sich zeigt, dass Verbraucher-Innen mehr sind als nur KonsumentInnen:
nämlich in erster Linie Individuen, denen einzelne Waren nur Mosaiksteine oder das Rohmaterial für ihre jeweiligen Interessen
sind. Dies kann über das mit dem Wort Konsumguerilla gebildete Oxymoron eine Gestalt erhalten: Betont wird das Spannungsverhältnis
der Begriffe Konsum und Guerilla, die zunächst gegensätzlich erscheinen, aber tatsächlich in mehrfacher Beziehung zueinander
stehen, sobald man an die vielschichtigen semantischen Bedeutungsumfelder denkt, die jeweils mit ihnen einhergehen.
Marktstrategien lassen sich demnach nicht allein durch einfache oppositionelle Akte demontieren oder variieren. Gerade Guerillataktiken
machen die Aneignung der materiell geprägten Welt zu einem attraktiven, motivierenden und möglicherweise für die Aktiven auch
besonders Erfolg versprechenden Unterfangen. Die für PartisanInnen konstituierende Wendigkeit auch in den hier behandelten
Marktarrangements ist dabei stets fortzuentwickeln, da jede subkulturelle Intervention vom Markt als Herausforderung gedeutet
werden kann, die auf potenzielle Marktlücken verweist und als solche dann Gefahr läuft, vom kommerziell getriebenen Kreislauf
wieder vereinnahmt zu werden. Dem unvorhersehbaren, aktiv gelebten Freiheitswillen Ausdruck zu verleihen, stellt dabei die
besondere Kunstfertigkeit dar, die sich nicht allein in Feldern wie Kunst, Kulturbetrieb und Jugendkulturen finden lässt und
daher multiperspektivisch und interdisziplinär betrachtet wird.
|18| Die Beiträge
Für die Einleitung untersuchte
Harry Wolff
gemeinsam mit den Herausgebern Synonyme als Indizien für gewandelte Rollen von KonsumentInnen aus dem Bereich des Marketings.
Hans Peter Hahn
führt mit einem Überblicksartikel zum Verhältnis von Konsum und Kultur in den Band ein. Er zeigt zentrale historische und
gegenwärtige Herangehensweisen an die Welt der Waren und des Konsums.
Franz Liebl
verdeutlicht mit dem Prinzip des Cultural Hacking, wie durch direkte Veränderung an Waren neue Bedeutungen geschaffen werden,
und wie diese kritischen, teils aber auch ökonomisch motivierten Eingriffe in die Welt der standardisierten Produkte wieder
neue kommerzielle Formen hervorbringen
Weitere Kostenlose Bücher