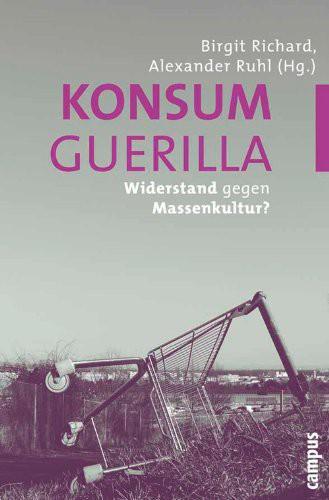![Konsumguerilla - Widerstand gegen Massenkultur]()
Konsumguerilla - Widerstand gegen Massenkultur
können.
Thilo Schwer
beleuchtet in seinem Beitrag Veränderungen im Möbeldesign durch BenutzerInnen, die Alltagsobjekte umgestalten, umnutzen und
damit individualisieren und wie diese Modifikationen als Gestaltungsstrategien im professionellen Bereich aufgenommen und
weiterentwickelt werden.
Sabine Fabo
stellt parasitäre Strategien in Kunst und Design vor, deren Ausrichtung zwischen den Angeboten des Marktes mit seinen namhaften
Marken als Bezugsgröße einerseits und Widerstand dagegen andererseits anzusiedeln sind.
Martina Seefeld
und
Jörg Hoewner
setzen sich mit den Neuen Medien, welche die Rolle von KonsumentInnen grundlegend umdefiniert haben, im Kontext von Unternehmenskulturen
auseinander. Bieten die Technologien des Web 2.0 Chancen für die Entwicklung eines Enterprise 2.0?
Verena Kuni
beleuchtet die Aktualität von Do it yourself-Strategien im Zusammenhang mit sozialen Prozessen, Kontexten und hieraus resultierenden
Effekten im Web 2.0 im Zusammenhang mit der Figur des Prosumers.
Nina Metz
stellt ein spezielles Motiv jugendkultureller Inszenierung in den Vordergrund: Den Reiz von Verletzungen und den Stolz auf
Wunden als eine Art der autonomen Formung des Körpers jenseits der im Mainstream aufwendig inszenierten Schönheitsideale.
Jutta Zaremba
beschäftigt sich mit neu entstandenen Kulturen von ComputerspielerInnen und ihren Aktivitäten auf den zugehörigen Websites
und Portalen im Internet.
Marcus Recht
wirft einen Blick auf die TV-Serie »Buffy« und analysiert darin subversive Momente wie auch Abweichungen in den Geschlechterrelationen
in einem Produkt der Massenkultur.
|19|
Alexander Fleischmann
und
Josef Jöchl
analysieren »queere« Strategien zwischen Abweichung und sozialer beziehungsweise kommerzieller Eingliederung in den »Mainstream
der Minderheiten« (Holert/Terkessidis) am Beispiel des Schwulenmagazins »BUTT«.
Jan Grünwald
analysiert Männlichkeitsbilder bei Selbstdarstellungen in der Web 2.0-Community und der Musikplattform MySpace anhand von
Stereotypenbildung wie auch Abweichungen, die Ansätze einer Typologie liefern können.
Das Interview mit
Diedrich Diederichsen
beleuchtet die künstlerischen Möglichkeiten des Widerstands gegen Konsum insgesamt.
Lev Manovich
fasst in seinem Überblicksartikel über die neuen sozialen Medienwelten die sozialen Bedingungen des Web 2.0 zusammen und untersucht,
wie das Social Networking vom Massenkonsum zur massenhaften kollaborativen Kulturproduktion führt.
Alexander Ruhl
verfolgt in seinem Artikel, wie die Streetart in ihrer Wanderung von der Straße ins Netz vom Kontext von Subversion des Urbanen
in das System Kunst als Neue Kunstform gerät.
Birgit Richard
sucht bei YouTube nach neuen Kunstformen für das bewegte Bild und findet jugendliche Bild- und Darstellungsformen, die so
vorher nicht existent waren und zur temporären Aufweichung der Grenzen zwischen Bildender Kunst (
high
) und Alltagskultur (
low
) führen.
Sabine Himmelsbach
betrachtet den Übergang und die Schnittflächen vom partizipativen, vernetzten Web 2.0 in die bildende Kunst und beleuchtet
ihre Möglichkeit, mediale Formate subversiv zu unterlaufen, sich diese damit anzueignen und autonome, unreglementierte Nutzungsformen
voranzutreiben.
Peter Mörtenböck
thematisiert die Aneignung und Neuvermessung der Stadt durch Free Running, das nicht nur die Grenzen und Restriktionen des
öffentlichen Raums, sondern auch die der materiell gebauten Umwelt als Herausforderung und ein Hindernis begreift, das im
wahrsten Sinne unter- oder überlaufen werden muss.
Jörg van der Horst
und
Christoph Jacke
beleuchten eine unerwartete Form der Subversion: den Hyperkonsum der Hochkultur am Beispiel der wagnerianischen Opern in Bayreuth.
Sie schildern den subversiven Applaus und erklären die Strategie der Überaffirmation respektive -negation, durch die eine
Hochkultur-Konsumguerilla geschaffen wird.
Den Band beendet
Birgit Richard
mit einem Einblick in ihre coolhunters: style-Studie, eine Befragung von Jugendlichen im Rahmen der Coolhunters-Ausstellung |20| mit Fokus auf Kleidungs- und Stilbilder, die deutlich die mediale Überformung und konforme Ausrichtung der meisten Jugendlichen
zeigt.
Literatur
Certeau, Michel de (1988),
Kunst des Handelns
, Berlin.
Hirschauer, Stefan (2004), »Praktiken und ihre Körper. Über materielle Partizipanden des Tuns« in: K. H. Hörning; J. Reuter
(Hg.),
Doing culture. Neue Positionen
zum
Weitere Kostenlose Bücher